
Missglückte Reise durch Deutschland (Kapitel 10.3) Aus «Schneesturm im Sommer»
Die geregelte Pflege durch freundliche Schwestern und eine peinliche Tagesordnung, der ich mich nicht ohne Widerstreben fügte, machten meinem etwas willkürlich verbrachten Krankendasein im Hotelzimmer ein Ende. Die Schwestern schüttelten belustigt den Kopf, wenn ich statt um sechs Uhr morgens erst um acht Uhr erwachen und frühstücken wollte oder bei Nachtanbruch zu lesen begann, statt das Licht zu löschen. Der Arzt, der mich auch hier regelmässig untersuchte, erklärte, dass ich die Krise überwunden habe, aber noch keineswegs geheilt sei und mindestens zehn Tage langliegen müsse. Beim Lesen merkte ich dann, wie sehr mich das Fieber geschwächt hatte, ich wurde oft müde und konnte am hellen Tag einschlafen. Wenn ich weder lesen noch schlafen konnte, wäre ich am liebsten spazieren gegangen, und da mir dies auch nicht möglich war, schaute ich, halb aufgerichtet, wenigstens zum Fenster hinaus.
Aber da draussen schlich ein kalter, grauer Tag vorüber, und mein Blick ging über einen unübersichtlichen Hinterhof auf die Rückseite kahler Backsteingebäude. Im Hofe befand sich zwischen hässlichen Schuppen ein Lager von Abfallstoffen, bei dem manchmal ein Kehrichtwagen vorfuhr und einen Schwarm von Möwen und Nebelkrähen aufjagte. Zuerst freute ich mich noch über die Vögel und achtete auf ihr Treiben, aber wenn ein paar ärmliche Männer stundenlang mit einer nur erratbaren widrigen Arbeit am Abfall beschäftigt waren, die Krähen wartend auf den Schuppendächern hockten und die Möwen in begierigen Flügen nur noch die Möglichkeit erspähten, einen Fetzen aus dem Kehricht zu reissen, wenn dazu ohne Unterbruch derselbe kalte Wind den Vögeln ins Gefieder blies und immer dieselbeschmutzige Nebelgräue darüber hing, wandte ich mich von diesem trostlosen, frühlingsfernen Grossstadtwinkel gern wieder ab. In diesen selben Tagen leuchtete daheim vielleicht schon die Wiese mit blühenden Märzenglöggli grün aus vergehenden Schneeresten, und der Haselbaum stand voller Kätzchen unter einem blauen Föhnhimmel, ich sah es als eine mir unentbehrliche Wirklichkeit vor Augen und verlangte danach wie noch nie.
Am Abend meines dritten Spitaltages wurde mir mitgeteilt, meine Frau sei hier eingetroffen. Ein paar Minuten später stand sie auf der Schwelle, in den kummervoll fragenden Augen noch die Qual einer langen Reise und noch längeren Ungewissheit über den Zustand ihres Mannes, aber bei meinem Anblick erlöst aufatmend, oder vielmehr zu diesem Aufatmen ansetzend, da sie keine alltägliche Last abzuwälzen hatte und trotz meiner Zuversicht nur allmählich wieder lachen lernte. Von nun an hatte ich mich über nichts mehr zu beklagen.
Nach meinem Auslandsurlaub würde ich daheim bald wieder die Uniform anziehen müssen, die Schweizer Armee stand seit Monaten mobilisiert im Aktivdienst. Um den Anforderungen der Zeit aber auch hier nicht auszuweichen, las ich Ernst Jünger weiter. Meine Frau, die in der Stadt wohnte, brachte mir den «Arbeiter», sein angeblich wichtigstes Werk, das ich nun unter dem Vorzeichen seiner fatalen Aktualität zu lesen begann, obwohl es über die herrschende Lage hinauszielt. Es geht hier nicht um den uns bekannten Arbeiter, sondern um die «Gestalt des Arbeiters» als einer «bestimmenden und massgebenden Grösse des kommenden Zeitalters», in dem es «nichts geben kann, was nicht als Arbeit begriffen wird». Es geht um die Notwendigkeit neuer Ordnungen, «died urch eine neue Vermählung des Lebens mit der Gefahr erzeugt sind».
Der Weg dazu führe über die Veränderung der Welt durch die Technik, besonders über die schon weit fortgeschrittene allgemeine Nivellierung, die das Individuum immer mehr abschleife und zunächst einen seelisch undifferenzierten, eindeutigen, gesunden «Typus» ergebe; in seiner schärferen Ausprägung, im «aktiven Typus», der eine zweite Stufe künftiger Rangordnung bezeichne, äussere sich schon «ein hohes Mass an Wucht und ausstrahlender Kraft». Sein geheimster Sinn sei auf Herrschaft gerichtet, daher werde Rüstung zur bedeutendsten Aufgabe im neuen Arbeitsraum. Im Endzustand der Technik deute sich an «die Ablösung eines dynamischen und revolutionären Raumes durch einen statischen und höchst geordneten Raum». – «Der Sprache ruhender Symbole, in denen die reine Existenz zur Anschauung spricht, ist es vorbehalten, davon Zeugnis zu geben, dass die Gestalt des Arbeiters mehr als Bewegung verbirgt: dass sie kultische Bedeutung besitzt.» – «Erst hier gewinnt das Kleid der Erde jene letzte Fülle und jenen Reichtum, in dem sich die Einheit von Herrschaft und Gestalt offenbart, und denk eine Absicht zu erzeugen vermag.»
Dies sind unzulängliche Andeutungen einer Reihe von Gedanken, die der «Entdeckung einer neuen und unbekannten Welt» gelten und im Zusammenhang damit eine oft hervorragend treffsichere Zeitkritik üben. Der Standpunkt, von dem sie ausgehen, liegt im Bewusstsein und im Gefühl vom Vorrang des Elementaren. «Der Arbeiter nämlich steht in einem Verhältnis zu elementaren Mächten, von deren blossem Vorhandensein der Bürger nie eine Ahnung besass.» Dem individuellen Geiste fällt keine schöpferische Aufgabe mehr zu. «Im Verzicht auf Individualität liegt der Schlüssel zu Räumen, deren Kenntnis seit langem verlorengegangen ist.»
Ernst Jünger ist im selben Fall wie einige seiner Vorläufer, er kämpft mit Geist gegen den Geist, wenn auch immerhin in der Hoffnung auf eine neue, «zauberische Einheit von Blut und Geist, die das Wort unwiderstehlich macht». Seine Formel lautet aber: «Die beste Antwort auf den Hochverrat des Geistes gegen das Leben ist der Hochverrat des Geistes gegen den Geist …» Man wird als Leser nicht gleich alle möglichen Einwände zur Hand haben, aber immer wieder Fragen stellen. Ist es notwendig, gegen das bürgerliche Sicherungsbestreben sich für das Elementare und Gefährliche noch besonders einzusetzen? Dies ist doch immer da, ob man es will oder nicht, es umkreist das gesichertste Bürgerleben wie ein unerbittlicher Belagerer, der bald hier, bald dort eindringt und als Tod am Ende sicher siegt. Um die bürgerliche Welt zu revolutionieren, kann man nicht zu diesem aussermenschlichen Belagerer überlaufen, ohne mit der bürgerlichen Welt und über sie hinaus auch alles das zu verraten, was ein höheres Menschentum immer erst möglich macht.
Für die Entstehung des Werkes ist aufschlussreich, dass als typischer Bewohner des neuen, elementaren Raumes vor allem der deutsche Weltkriegssoldat vom Schlage Jüngers erscheint. Vor dem Massstab, mit dem er gemessen wird, versagt der uns vertraute Bildungsbegriff: «Was aber sind das für Geister, die noch nicht einmal wissen, dass kein Geist tiefer und wissender sein kann als der jedes beliebigen Soldaten, der irgendwo an der Somme oder in Flandern fiel?»
Zu bedenken ist, dass der Jünger’sche Soldat des Weltkrieges, der ein Höchstmass «von aktiven Tugenden, von Mut, Bereitschaft und Opferwillen» besitzt, die katastrophalen Zustände in Deutschland nach dem Weltkrieg am eigenen Leib erlebte; er musste sich in einem tiefen Gegensatz zum entmutigten, passiven und so erfolglos berufenen Nachkriegsbürger fühlen, er wollte nichts wissen von Verhandlung, Nachgiebigkeit, Kompromiss, denn sein grosses Erlebnis war das Gegenteil davon, die Bewährung im Kampf. Aber nun war er ausgeschaltet und empfand das, was rings um ihn geschah, als Untergang,ü berdies mochte er das Bewusstsein kaum ertragen, dass die unerhörten Anstrengungen und Opfer eines ganzen Volkes im Weltkrieg umsonst gewesen sein sollten. Unter dem Druck dieser Not versuchte er sich in dieser «Gestalt des Arbeiters» als beispielhaften Träger eines heraufkommenden neuen Zeitalters zu begreifen und dem verlorenen Krieg die furchtbare Sinnlosigkeit zu nehmen, indem er ihm über den nationalen Bezug hinaus eine neue, höhere Bedeutung gab.
Hier liegt eine Wurzel des Werkes, und durch denselben erschütterten Nährboden führt auch eine Wurzel der nationalsozialistischen Ideologie. Die Ergebnisse decken sich nur scheinbar, im Zwielicht der deutschen Öffentlichkeit, und sind von ganz verschiedener Höhe. Zweifellos hat die Bewegung bei Jünger ihre Anleihen gemacht und seinem Buch zugleich Resonanz verschafft; ein wichtiges Parteiblatt hält ihn für berufen, «unserem Volke den Weg zu weisen zu der neuen politischen und sozialen Ordnung einer kriegerisch heroischen Welt».
Jünger selber aber vermeidet in diesem Buche das Wort Nationalsozialismus, obwohl er indirekt gelegentlich auf die Bewegung Bezug nimmt, er braucht «Rasse» nicht im Sinn des biologischen Rassebegriffes, hält die Diktatur nur für eine Übergangsform und erklärt: «Es muss sich herausstellen, welche von den mannigfaltigen Erscheinungen des Willens zur Macht, die sich berufen fühlen, die Legitimation besitzt.» Er soll übrigens, wie man sich zuflüsterte, der Aufforderung nicht nachgekommen sein, öffentlich und aktiv an der Bewegung mitzuarbeiten. In einem späteren Aufsatz («Über den Schmerz») heisst es: «Man kann eine ‹heroische Weltanschauung› nicht künstlich züchten.» Hier findet sich auch das Zugeständnis, dass zwar «neue Ordnungen bereits weitgehend vorgestossen, dass aber die diesen Ordnungen entsprechenden Werte noch nicht sichtbar geworden sind».
Zum Autor
Meinrad Inglin (1893–1971) Sohn eines Goldschmieds, Uhrmachers und Jägers, wurde mit siebzehn Jahren Vollwaise. Uhrmacher- und Kellnerausbildung, trotz fehlender Matura Studium der Literaturgeschichte und Psychologie in Bern, Genf und Neuenburg. Tätigkeit als Zeitungsredaktor, während des Ersten und Zweiten Weltkriegs Offizier im Grenzdienst. 1922 als Journalist in Berlin, danach als freier Schriftsteller in Schwyz. Für sein Werk (vor allem Romane und Erzählungen, einzelne Aufsätze, Notizen und eine Komödie) wurde Inglin vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Grossen Schillerpreis und dem Gottfried-Keller-Preis.
Vor der Nachtruhe wurde jeweilen leise meine Zimmertür geöffnet, und draussen erklang der fromme Abendgesang der Schwestern; darauf erschien ein stilles Gesicht im Türrahmen und nickte freundlich, die Tür ging zu, und eine selten gestörte, friedliche Nacht begann.
Eines Tages ging die Tür zur Unzeit auf und blieb geöffnet, eine barsche Rede drang herein, der Führer sprach im Rundfunk. Auch im Ausland hat man dem unheimlich verstiegenen Mann jeweilen zugehört. In Deutschland war seine Wirkung erstaunlich. Das unkritische breite Volk, zu dem er vor allem sprach, wurde durch den Ton seiner Rede, durch das beherrscht leidenschaftliche harte Hämmern, das drohende Crescendo, das Furioso, gepackt und angesteckt. Unsere Krankenschwestern widerstanden ihm nicht. Diese sanften, frommen Wesen, die gewiss hundert Vorbehalte gegen die Gewaltsamkeit der Bewegung auf dem Herzen hatten, liessen sich wenigstens für den Augenblick zu einer Gesinnung überreden, die ihrem ganzen Dasein widersprach.
Wer mochte sich da noch wundern, wenn die wehrhafte Jugend, die eine Neigung dafür besass, begeistert zustimmte? Die Einsichtigen und Widerstrebenden mussten schweigen oder verderben, die anfänglich Schwankenden wurden mitgerissen. Wer später über die Haltung des breiten Volkes zu Gericht sitzen will, wird sich vorerst fragen müssen, ob er selber beizeiten etwasdagegen getan hat, und auch dann wird er nur mit einer sehr humanen Psychologie und nicht mit einem streng moralischen Massstab um ein Fehlurteil herumkommen. Und wer wird jene ohnehin verwischten Grenzlinien nachziehen wollen, auf denen im einzelnen, noch gar nicht zur politischen Verantwortung erzogenen Menschen das bisher Geglaubte verraten und das Neue geglaubt wurde oder eine ursprüngliche Gleichgültigkeit in ein opportunes Bekennertum hinüberwechselte. Dies alles dürften die Deutschen einmal unter sich auszumachen haben. Ihre alliierten Gegner aber, die künftigen Siegerstaaten, werden nach dem Schuldspruch über die Verantwortlichen dem unglücklichen Volke nur eine Generalabsolution erteilen können.
Nach zehn Spitaltagen ging ich mit meiner Frau zum ersten Mal ins Freie, aber ein kurzer Gang zum nahen Park ermüdete mich so, dass ich dort gern auf einer Bank ausruhte. Durch die dürftig begrasten Flächen unter den kahlen Bäumen liefen Schützengräben, die offenbar von der hier spielenden Schuljugend angelegt waren, aber in ihrem Verlauf, mit ihren Verbindungsgängen, Brust- und Schulterwehren eine schon mehr als spielerische Kenntnis verrieten. Aus einem Hinterhalt tauchte plötzlich ein rüder Knirps mit einer Kinderpistole vor uns auf, zielte, schoss und warf sich in die nächste Deckung. Zwei Tage darauf sah ich einem Gassenjungen zu, der mit gerunzelter Stirn den Wagen des Generalkonsuls musterte; vor dem Schild mit dem C. C., dessen Bedeutung ihm bekannt sein mochte, rief er auffahrend: «Und sowas hat noch Benzin!» Rief es, spuckte aus und schlenderte entrüstet von dannen.
Sobald ich mich wieder ordentlich auf den Beinen halten konnte, fuhren wir, meinen alten, dringenden Knabenwunsch erfüllend, nach Stellingen hinaus zu Hagenbeck, wo meine besorgte Frau dann freilich ihre liebe Müh und Not hatte, mich beizeiten wieder wegzubringen. Vor der Abreise zeigte uns der ortskundige Präsident des Schweizervereins bei stürmischem Wetter noch so viel von Hamburg, als in der kurzen Frist möglich war, genug, um uns den Abschied vom Eigenartigen und Merkwürdigen dieser Stadt zu erschweren. Wir versprachen, in einer friedlicheren Zeit dahin zurückzukehren, und dann wollten wir in den Häfen und Kanälen herumfahren, zwischen Werften, Kranen und Schiffen aller Art, zu den Dampfern, die, vom Zauber der Ferne umwoben, aus märchenhaften Ländern wieder hier einlaufen würden, wollten die Elbe hinab zur unübersehbaren Mündung und an einsame Küsten vor das offene Meer.
In dunkler Morgenfrühe fuhren wir von Altona aus, wo der in Hamburg sich rasch überfüllende Zug noch ein paar Plätze hatte, nach Berlin. Hier meldeten wir uns auf der schweizerischen Gesandtschaft, und ich berichtete dem Minister, der inzwischen auf seinen Posten zurückgekehrt war, kurz das Wesentliche über meine missglückte Reise. Während er uns die repräsentablen Gesandtschaftsräume zeigte, kamen wir ins Gespräch über das unvermeidliche Thema. Auch er beklagte sich über den neutralitätswidrigen Mutwillen besonders der kleineren Schweizerpresse, der von den zuständigen deutschen Stellen keineswegs übersehen, sondern peinlich angekreidet werde, und betonte, dass diesem ungeheuer mächtigen neuen Reiche gegenüber doch nur ein Verhältnis auf freundschaftlichem Fuss erträglich und fruchtbar sei.
Ich erinnerte ihn daran, dass man mit allgemeineren freundschaftlichen Gefühlen für das Dritte Reich in der Schweiz nicht rechnen dürfe und dass man ja ihm selber in gewissen politischen Kreisen der Heimat gram sei, weil er angeblich mit prominenten Nationalsozialisten freundschaftliche Beziehungen pflege und nicht entschieden genug als Exponent einer Demokratie auftrete. Darauf erwiderte er bitter, er möchte den schweizerischen Gesandten sehen, der ohne solche Beziehungen wirtschaftlich so viel erreichen würde wie er. Zweifellos wusste er genauer als irgendjemand, was er seiner Aufgabe schuldig war, einer Aufgabe von äusserst delikater Natur, die vor allem unter den jetzt und heute herrschenden Umständen erfüllt werden musste und nicht im unbestimmten Hinblick auf vielleicht anders laufende künftige Entwicklungen.
Nachmittags trieben wir uns noch in ein paar Buchhandlungen herum. Nationalsozialistische Literatur lag in Menge auf, ohne, wie es schien, noch besonders begehrt zu werden. Ich fragte unter der Hand nach dem, was nicht mehr da sein durfte, und es schien wirklich nicht mehr vorhanden, doch fand ich unter beiseitegeschobenen Restbeständen noch ein paar Einzelausgaben von Werken Hofmannsthals, die ich sogleich kaufte, so den unvergleichlichen «Andreas»; vom Nachwort Wassermanns liess sich nur noch die erste Seite erraten, die sorgfältig mit dem vorhergehenden Blatt zusammengeklebt war, der Rest fehlte. Von Ernst Jünger war bei weitem nicht alles zu haben; ich nahm «Das abenteuerliche Herz» in der zweiten Fassung mit, ein ungewöhnliches Buch, das ich während einer Teestunde, die wir einschalteten, schon angeregt durchblätterte. Hier wird manches zum ersten Mal gedacht, bemerkt, anschaulich gemacht, und wo es um mehr oder weniger bekannte Dinge geht, werden sie von einer neuen Seite gezeigt oder in überraschende Zusammenhänge gerückt. Dabei ist alles unmittelbarer, gegenständlicher als im «Arbeiter», auch Schwieriges, und mit einer seltenen Klarheit und Prägnanz gesagt. Jünger darf nicht nur nach dem «Arbeiter» beurteilt werden; in seinen späteren Schriften sind die Bezüge darauf ohnehin spärlicher und unverbindlicher, als dieses Werk in seiner scheinbar so zentralen Stellung erwarten liesse.
Wir sassen in einer bekannten Konditorei am Potsdamer Platz, die ich früher oft besucht hatte, und begnügten uns schweigend mit dem schlechten Ersatz, der allein noch zu haben war; niemand hielt sich darüber auf, Genuss war nicht mehr zeitgemäss, Entbehrung selbstverständlich.
Am späten Abend betraten wir eine Stunde vor dem Abgang des Zuges den Anhalter Bahnhof, gerade noch früh genug, um in einem Abteil Platz zu bekommen. Schlafwagenplätze hatten wir schon vor acht Tagen umsonst bestellt, wir hätten vierzehn Tage vorher anfragen oder die Heimreise hinausschieben müssen. In unserem Abteil sass unter lauter Zivilisten ein Hauptmann in Uniform, ein Mann mittleren Alters mit straffen Zügen und verschlossener Miene. Er sass aufrecht da und folgte bei der Abfahrt des Zuges mit keiner Bewegung dem Beispiel der übrigen Reisenden, die im Hinblick auf die lange Fahrt nun eine bequemere Haltung annahmen.
Da ich beim blauen Nachtlicht nicht lesen konnte, überdachte ich noch einmal meine Reise und fand, dass ich von jenem hochgerüsteten, organisatorisch äusserst angespannten Deutschland, das die Welt in Atem hielt, doch recht wenig gesehen hatte. Es blieb dem Ausländer verborgen, es paradierte nicht mehr wie vor 1914, aber es war da, auf abgelegenen Übungsfeldern, auf Flugplätzen, in Amtsgebäuden, Kasernen, im überall spürbaren Bewusstsein der Bereitschaft im Westen, und es hielt das deutsche Leben unter einem Druck, dem niemand ausweichen konnte, es wäre denn nachinnen. Auch von deutscher Kunst hatte ich diesmal wenig gesehen, aber dafür neue Menschen kennengelernt und ein paar persönliche Erfahrungen gemacht, die man nicht zwischen seinen vier Wänden geschenkt bekommt.
Um Mitternacht versuchte man in unserem Abteil mit den gewohnten Zeichen des Unbehagens endlich einzuschlafen, oder man schlief auch schon und vergass eine Weile, wie man aussah, um wieder wachgerüttelt zu werden, die Beine anders zu strecken und entspannt sich abermals zu vergessen. Der Hauptmann sass, leicht ans Rückpolster gelehnt, immer noch aufrecht da und vergass sich keinen Augenblick.
Um drei Uhr konnte man in einer grossen, düsteren Bahnhofhalle ein Bulletin kaufen, das den Abschluss des Krieges zwischen Russland und Finnland meldete. In unserem Abteil wurde das Ereignis lebhaft besprochen, eines der vielen Ereignisse, die den Beginn des Weltkrieges in einem so undeutlichen, rasch wechselnden Lichte zeigten. Der Hauptmann hörte aufmerksam zu, doch als man versuchte, ihn ins Gespräch zu ziehen, nahm er nach ein paar höflichen Worten so unmissverständlich Abstand, dass niemand den Versuch wiederholte. Ungezwungen, doch aufrecht und schweigend, sass er auf der weiteren Fahrt wieder da, und erst in Stuttgart verliess er mit einem knappen militärischen Gruss das Abteil.
Er war die ganze Nacht durchgefahren, ohne seine Haltung zu lockern, und verriet keine Spur vom unfrischen, übernächtigten Zustand, in dem die anderen Reisenden endlich den Morgen erlebten. Es war die Haltung, die der deutsche Soldat, der Offizier, der Öffentlichkeit und der Welt gegenüber einnimmt, unabhängig vom jeweiligen politischen Schicksal, das sich seiner bedient. Er hält jede Probe aus, er lässt sich nie gehen und lässt auch nicht ohne weiteres mit sich reden. Es ist die äussere Form einer unheimlichen Disziplin und soldatischen Tüchtigkeit. Diese Haltung ist älter als die von ihr freilich mitbewirkte des nationalsozialistischen Kämpfers, und sie enthält auch heute noch in vielen Fällen mehr, als man hinter der metallischen Härte des Jünger’schen Soldatengesichtes finden wird. Die alten preussischen Tugenden sind in den Augen der Welt durch den Militarismus und nun wieder durch den Nationalsozialismus kompromittiert worden. Ihre wirklichen Träger besitzen zur Zucht und Tapferkeit ein Ehrgefühl, das nicht nur die eigene Ehre, sondern auch die der Mitmenschen bedenkt, und nur sie dürften noch die bei den Nationalsozialisten in Verruf gekommene Fähigkeit besitzen, eine Niederlage hinzunehmen.
Die wohlwollende Annahme, dass es neben dem nationalsozialistischen noch ein zum Schweigen verurteiltes anderes, besseres, humaneres Deutschland gebe, hat im gegnerischen Lager immer mehr an Boden verloren. Die Annahme ist aber richtig, es gab und gibt dieses andere Deutschland, wie es neben dem faschistischen Italien immer auch noch ein anderes gab. Dieses humanere Deutschland muss eines Tages die Soldaten wieder an die friedliche Arbeit schicken, die Jugend in die Schulstuben zurückführen, politisch Gestalt annehmen und sich zur europäischen Kulturgemeinschaft bekennen, zu der es gehört.
- Die «Editorische Notiz» zum Buch finden Sie hier.
- Jeweils sonntags wird der Roman «Schneesturm im Hochsommer» auf zeitlupe.ch fortgesetzt.
- Weitere Kapitel können Sie hier lesen.
«Schneesturm im Sommer»
Meinrad Inglin ist einer der bekanntesten Unbekannten, seinen Namen kennen fast alle, seine Werke die wenigsten. Dabei ist er ein grosser Könner in einem grossen Spektrum unterschiedlicher literarischer Genres, stilistisch abwechslungsreich und sprachlich wohlkomponiert. «Schneesturm im Hochsommer» versucht, sein vielfältiges Schaffen abzubilden und damit einen literarisch hochinteressanten und oft überraschend aktuellen Schweizer Klassiker wieder breiter bekanntzumachen.
«Inglin ist seit Jahren genau der, von dem viele sagen, man hätte ihn ‹nicht auf dem Schirm› und der deshalb allen so präsent ist. Die Frage ist doch vielmehr: Was macht den Kerl so interessant, dass er nicht verschwindet? Er hat nie auf Effekt geschrieben. Er hat versucht, Verhältnisse zu beschreiben, wie sie sind. Eine Haltung, die nach dem ganzen postmodernen Klimbim auf eine neue Art interessant ist.»
Peter von Matt
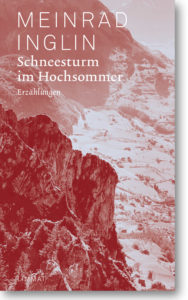
Meinrad Inglin, «Schneesturm im Hochsommer».
Herausgegeben von Ulrich Niederer, Nachwort von Usama Al Shahmani, 256 Seiten, Leinenband, CHF 28.– (UVP), Limmat Verlag, Zürich
Umschlagfotografie: Dino Reichmuth, Unsplash
Typografie und Umschlaggestaltung: Trix Krebs
Druck und Bindung: Friedrich Pustet, Regensburg
ISBN 978‑3‑03926‑021-8
© 2021 by Limmat Verlag, Zürich www.limmatverlag.ch
