
Die Lawine (Kapitel 2.2) Aus «Schneesturm im Sommer»
Die niedergegangenen Schneemassen bedeckten die Schluchtsohle verschieden hoch auf einer Breite von hundert bis zweihundert Metern und einer von unten her nicht abzuschätzenden Länge, sie waren hart gepresst und boten gegen die Brückenpfeiler hinauf den Anblick eines zerrissenen, von Altschnee überlagerten Gletscherabbruches. Die Schluchthänge dagegen waren von pulverigem Schnee so hoch überstäubt, dass man stellenweise bis über die Hüften darin versank. Da und dort ragten dunkle Gegenstände aus der harten Masse, und die Leute liefen eilig danach, aber es waren abgesplitterte Stämme, Strünke und Äste. Der Leutnant sammelte seine Mannschaft am untersten Ausläufer, wo der gestaute Bach versiegte, und liess sie in lockerer Linie langsam suchend über die Schneeschuttmassen hinauf vorrücken. Es schien hoffnungslos, irgendwo nach der verunglückten Schildwache graben zu wollen, und so musste wenigstens versucht werden, wenn nicht sie selber, so doch eine Spur von ihr an der Oberfläche zu finden.
Die Suchmannschaft kam in die Nähe der kirchturm hohenBrückenpfeiler und wollte die Hoffnung schon aufgeben, als das Unglaublichste geschah. Aus dem Pulverschnee am linken Schluchthang arbeitete sich mit müden Bewegungen ein weiss überstäubter Mann an den Rand der Lawinenmasse hinauf, und der Mann war – die Leute, die ihn entdeckten, rannten, seinen Namen schreiend, zu ihm hinab –, der Mann war Schelbert.
Er stand da, als seine Kameraden ihn umringten und der Leutnant vor ihn hintrat, blickte sie mit verstörten Augen an und schien die Sprache verloren zu haben.
«Schelbert», sagte der Leutnant, «jetzt fange ich an zu glauben, dass Sie einen Schutzengel haben. Ist doch das reinste Wunder, dass Sie noch leben!»
Schelbert blickte ihn an und schwieg.
«Er ist noch nicht ganz beisammen», sagte einer seiner Kameraden leise. «Vielleicht ist er auf den Kopf gefallen.»
Sie suchten ihn dadurch zu wecken, dass sie alles erzählten, was sie gesehen hatten, und ihm Einzelheiten in Erinnerun griefen. Sie sagten ihm, dass er als Schildwache da oben die Lawine zu spät bemerkt habe, dass er beim Fortrennen gestolpert, hingefallen und gleich nach dem Aufstehen vom Luftdruck über das Geländer hinaus geschleudert worden sei. «Wir haben doch jetzt die ganze Lawine nach dir abgesucht, wir dachten, du seiest mausetot.»
Schelbert schwieg noch immer, hörte aber jetzt so angestrengt zu, als ob er wirklich versuchte, sich das alles in Erinnerung zu rufen.
«Sie haben beim Sturz wahrscheinlich das Bewusstsein verloren», erklärte der Leutnant. «Aber vielleicht fällt Ihnen doch dies und jenes noch ein. Es wäre interessant zu wissen, wie und wo Sie gelandet sind … vermutlich doch weiter unten, oder? Und dann sind Sie, bevor wir kamen, da hinaufgegangen?»
Schelbert machte eine Kopfbewegung, die man für ein Ja nehmen konnte.
«Vielleicht wollten Sie Helm und Gewehr suchen, die haben Sie beim Sturz doch verloren, nicht?»
«Helm und Gewehr?», fragte er nun dumpf und dachte einen Augenblick nach. «Die muss ich vielleicht da oben suchen.»
«Auch möglich. Sie wurden ja nur so herumgewirbelt, das hat man gesehen. Aber der Luftdruck muss Sie nicht nur hochgenommen, sondern nachher getragen und glimpflich abgesetzt haben … oder Sie sind von einer Art Unterströmung, die unter der Brücke durchkam, aufgefangen worden … Verstehen kann man es nicht, es scheint ganz unglaublich. Aber die Hauptsache ist, dass Sie davongekommen sind.»
Damit schickte er ihn mit den übrigen Leuten in die Baracke zurück und ging der Reservemannschaft entgegen, die mit Pickeln und Schaufeln durch die Schlucht heraufkam. Er traf seinen Hauptmann dabei, erstattete Meldung und hatte Mühe, ihm das Vorgefallene glaubhaft zu machen. Die Mannschaft wurde auf dem kürzesten Weg zur Brücke hinaufgeführt, wo sie die hoch überpulverten Geleise auszuschaufeln hatte. Die untere Station schickte einen Reparaturwagen mit Arbeitern, die den Strom ausschalteten und die von verbogenen Trägern herunterhängende Fahrleitung zu flicken begannen.
Schelbert wich allen Fragen aus, er blieb schweigsam, nachdenklich, ja bedrückt, wie ein Mensch, der etwas Schweres zu ertragen hat, ohne es verstehen zu können. Aber plötzlich verlangte er, seinem Leutnant und dem Herrn Hauptmanneine Aussage zu machen. Er wurde in die Barackenkammer des Wachtkommandanten gewiesen, nahm beim Eintritt der beiden Offiziere mit finsterer Miene stramm Stellung an und gestand, dass er ein schweres Wachtvergehen zu bekennen habe. Der Hauptmann bat den Leutnant, ein Protokoll aufzunehmen, und das Verhör begann.
Schelbert erzählte, wie er als Schildwache bei der Brücke jene Bäuerin kennengelernt habe, eine junge Witwe, und sie gern vor der Ablösung noch daheim besucht hätte. Er habe vom Leutnant keine Bewilligung zum Ausgang mehr erhalten, aber sich nicht damit abfinden können. Die Bäuerin sei dann gestern noch einmal zur Brücke herabgekommen, da hätten sie zusammen einen Plan gemacht, und genau nach diesem Plane habe er heute Morgen seinen Schildwachposten verlassen und die Zeit bei der jungen Bauernfrau verbracht.
Der Leutnant schlug mit der flachen Hand auf den Tisch und blickte den Geständigen verblüfft an, der Hauptmann bemerkte sehr ernst, ein solcher Fall werde nicht disziplinarisch erledigt werden können, sondern vor Divisionsgericht kommen.
Schelbert nahm dies ruhig hin und fuhr unbeirrt in seinem Berichte fort. Daraus ging hervor, dass er sich vom Korporal um sieben Uhr als Schildwache bei der Brücke aufführen liess, jedoch schon mit der Absicht, nicht hier stehen zu bleiben. Kaum war der Korporal verschwunden, als die junge Frau mit ihrem halb verblödeten Knecht über den Steg kam. Der Knecht war als Soldat verkleidet, er trug die Uniform und Ausrüstung ihres verunglückten Mannes, der vor zwei Jahren an dieser Stelle vom Lawinenwind in die Schlucht hinuntergefegt worden war. Sie sagten ihm, dass er hier nun Schildwach stehen müsse, bis Schelbert zurückkehre, sie schärften ihm ein, wie er sich zu verhalten habe, um nicht aufzufallen,und warnten ihn auch vor der Lawine wie vor den Zügen. Der armselige Mensch, der hier schon mancher Schildwache neugierig grinsend zugesehen hatte, stellte sich gelehrig an und begann den Dienst, erfüllt vom Gefühl seiner Wichtigkeit, mit kindischer Freude. Schelbert und die Frau aber stiegen eilig zu dem nahen Heimwesen hinauf. Während sie noch beisammen waren, hörten sie am gegenüberliegenden Berghang die Staublawine niedergehen. Sie rannten zur Brücke hinab, suchten den verkleideten Knecht und fanden ihn nicht mehr. Schelbert stieg ins Tobel hinunter, um dort nach der Leiche zu suchen, und wurde dabei von der Suchmannschaft des Wachtpostens entdeckt. Von ihr erfuhr er das Geschehene, und weil dabei nur von seiner eigenen wunderbaren Rettung die Rede war, konnte er in seiner Verwirrung die Wahrheit nicht gleich sagen.
Dies war sein Bericht. Das Protokoll wurde ihm vorgelesen, er unterschrieb es und bat am Ende, dass man doch jetzt den Verunglückten in der Schlucht suchen möge. Der Hauptmann versprach, die verlangten Leute vom Lawinendienstmit den Sondierstangen und dem Hunde sofort an die Arbeit zu schicken.
«Schelbert, Sie wissen offenbar, was Sie getan haben», schloss der Hauptmann. «Das Divisionsgericht ist streng und wird Sie zu einer schweren Strafe verurteilen. Dass Sie aber aus eigenem Antrieb bekannt haben und also die Strafe auf sich nehmen wollen, wird als Milderungsgrund sehr ins Gewichtfallen. Ich meinerseits verzichte besonders aus diesem Grunde, Sie hier sogleich einzusperren. Sie gehen jetzt zu Ihrem Zuge zurück!»
Zum Autor
Meinrad Inglin (1893–1971) Sohn eines Goldschmieds, Uhrmachers und Jägers, wurde mit siebzehn Jahren Vollwaise. Uhrmacher- und Kellnerausbildung, trotz fehlender Matura Studium der Literaturgeschichte und Psychologie in Bern, Genf und Neuenburg. Tätigkeit als Zeitungsredaktor, während des Ersten und Zweiten Weltkriegs Offizier im Grenzdienst. 1922 als Journalist in Berlin, danach als freier Schriftsteller in Schwyz. Für sein Werk (vor allem Romane und Erzählungen, einzelne Aufsätze, Notizen und eine Komödie) wurde Inglin vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Grossen Schillerpreis und dem Gottfried-Keller-Preis.
«Zu Befehl, Herr Hauptmann!», rief Schelbert, und dann bemerkte er noch, mit demselben schweren Ernst, den er während seiner ganzen Aussage bewahrt hatte, Helm und Gewehr seien noch dort oben bei der Frau, er habe in der Hast vergessen, sie mitzunehmen.
Der Hauptmann fragte den Leutnant, dann Schelbert, ob von seinem Zuge einer das Heimwesen kenne, und da man keinen wusste, entschied er, dass Schelbert selber Helm und Gewehr hole.
So kam es, dass vor der Ablösung der Kompagnie der verwandelte Soldat und die mitschuldige junge Frau einander noch einmal trafen. Was sie dabei besprachen und was sievorher zusammen erlebt hatten, kam erst bei den Verhandlungen vor Divisionsgericht an den Tag. Bis dahin bewahrte Schelbert ein Schweigen, das nichts preisgab als den blossen Tatbestand. Am Vorabend aber gelang es dem menschlich erfahrenen Verteidiger, dem spröden Burschen Geständnisse zu entlocken, die seine zwar offenbare, aber doch nicht ganzdurchsichtige innere Wandlung erklärten und begründeten.
Er hatte, wie er beschämt und ungeschickt gestand, bei der jungen Bäuerin mehr gefunden als das gesuchte flüchtige Vergnügen, nämlich das, was einem so leichtsinnigen Burschen wohl nur einmal begegnet, was ihm plötzlich die Augen öffnet und ihn, wenn er etwas wert ist, nun erst zum Manne macht. Noch eh jene Stunde zu Ende war, fragte er sie, ob sie seine Frau werden wolle. Sie erwiderte, sie sei mit ihrem ersten Manne nicht glücklich gewesen und möchte sich diesmal nicht wieder so rasch und unbedacht entschliessen, doch gefalle er ihr, sonst hätte sie ihn ja niemals zum Besuche ermuntert, und sie werde ernsthaft darüber nachdenken. Da fuhr drüben mit dem unheimlichen Fauchen, das sie kannte, die Lawine den Berg hinunter. Sie rannten zur Brücke hinab, und als sie den Knecht nicht fanden, packte die Frau den Soldaten mit beiden Händen an den Schultern und sagte erschüttert, mit Sätzen, die er nur allmählich in ihrem Zusammenhang verstand, dass sie nicht wisse, ob die sein Fluch oder ein Segen sei. Sie habe gewünscht, ihren ersten Mann loszuwerden, und die Lawine habe ihn weggenommen. Dann habe sie gewünscht, diesen beschwerlichen Knecht loszuwerden, und auch ihn habe die Lawine genommen, im gleichen Soldatenkleid, mit dem gleichen Gewehr und Helm wie ihren Mann, als ob sie das erste Unglück hätte wiederholen und bekräftigen wollen.
«Dafür hat sie mich verschont», antwortete Schelbert, als er es begriff. «Auch ich hätte hier das Leben verlieren können; stattdessen ist mir, als ob ich es bei dir erst recht gewonnen hätte. Für mich hat es nun dieser arme Mensch verloren, du er hat es in der gleichen Uniform verloren wie der Mann, der nicht zu dir passte; dies alles sollte nicht umsonst geschehen sein, auch wenn der unglückliche Knecht dadurch von seinem elenden Dasein erlöst worden ist. Ich kann es nur so ansehen,und wenn du es auch so ansiehst, ist es für uns beide ein Segen.»
Da kamen sie überein, das Ereignis als ein ungeheures Zeichen anzusehen, das sie beide für immer aufeinander anweise, und sie versprachen sich noch auf der Brücke feierlich, Mann und Frau zu werden. Darauf stieg der Mann in die Schlucht hinab, um den Verunglückten zu suchen, und die Frau rief ihm nach, dass sie daheim auf ihn warte.
Er hätte es leicht gehabt, vor seinem Leutnant den wunderbar Geretteten zu spielen, sein schweres Wachtvergehen zu verheimlichen und vielleicht später bei der Schneeschmelzeden Verunglückten zu suchen und beiseitezuschaffen, aber nach dem, was auf der Brücke geschehen war, konnte er zuerst nur schweigen. Als er dann wieder bei der Frau eintraf, um Gewehr und Helm zu hol en, sagte er zu ihr: «Ich habe mich als Schildwache schwer vergangen, schwerer, als du begreifen kannst, und ich bin immer noch ein Soldat. Meinst du nicht, dass da etwas Dreckiges an mir hängen bliebe, auch wenn alles andere so kommen musste, wie es kam?»
«Doch!», antwortete sie rasch. «Du musst es bekennen und die Strafe annehmen. Es ist für uns ja auch dann noch kein ganz sauberer Anfang, weil wir doch daran schuld sind, dass der Seppetoni um sein armes Leben gekommen ist. Ich will eine heilige Messe für ihn stiften, und bei der Brücke sollte auch er ein Kreuz haben. Bekenne du nur, wir wollen das nicht auch noch mittragen!»
«Das freut mich», sagte er. «Ich habe es schon gestanden, ich werde vor Divisionsgericht kommen und viele Monateabsitzen müssen, aber dann bin ich es los.»
Sie erschrak über eine so schwere Strafe, aber sie musste ihm recht geben und versprach, getreulich auf ihn zu warten.
Dies alles erfuhr der Verteidiger auf eine etwas umständlichere, sprödere Art am Vorabend der Verhandlungen; er stellte es in seiner Verteidigungsrede schonend, aber eindringlich so dar und rückte damit den schwierigen Fall erst in jenes rechte Licht, das ihn über das starre Gesetz hinaus dem lebendigen menschlichen Urteil unterbreitete. Das Gericht tönte in seinem Wahrspruch denn auch an, eine so ausserordentliche Verknüpfung von Zufällen, die zu einer so entschiedenen inneren Wandlung des Fehlbaren und am Ende noch zu einem so erfreulichen Ergebnis führe, könne man fast nur noch Schicksal nennen. Es verurteilte den Angeklagten zu sechs Monaten Gefängnis, jedoch bedingt, zu einer Strafe also, die ihn wohl noch bedrohen und an sein Vergehen erinnern, aber nicht mehr erreichen konnte, da er selber keinen Augenblick an seiner künftigen Bewährung zweifelte. Sein Leutnant beglückwünschte ihn dazu und meinte, es sei märchenhaft, wie sich ihm alles zum Guten gewendet habe. Schelbert erwiderte ernsthaft: «Es hat so kommen müssen.»
Als der sehr nüchtern denkende Hauptmann die Begründung des Urteils gelesen hatte, sagte er lachend zu seinem Leutnant: «Der Aufwand, den das Schicksal da getrieben hat, um aus zwei einfachen Menschen ein Paar zu machen, scheint mir denn doch etwas reichlich.»
«Zugegeben!», erwiderte der Leutnant. «Aber ein Mensch wie dieser Schelbert ist mir auch noch nie vorgekommen. Er kann über Abgründen herumklettern, er fällt nicht herunter, er kann im Tunnel einem abspringenden Bremsklotz ausgesetzt sein, er wird nicht getroffen, er kann in diesem Tunnel vor dem Zug herrennen, er wird nicht überfahren, er kann als Schildwache auf einen Posten gestellt werden, wo eine Lawine alles hinwegfegt, er gerät nicht in die Lawine, er kann sich eines schweren Vergehens schuldig machen, er muss die Strafe nicht antreten. Es ist ihm bestimmt, eine junge Bäuerin zu heiraten, und da kann er das Verkehrteste, Verbotenste tun, er tut dennoch immer das Richtige und wird auf diesem scheinbar verrückten Umweg auf die unglaublichste Art geradenwegs ans Ziel geführt. Und zuletzt behauptet er noch, dass alles so habe kommen müssen! Wenn das nicht mehr ist als Glück, dann weiss ich nicht, was man Schicksal nennen sollte.»
- Die «Editorische Notiz» zum Buch finden Sie hier.
- Jeweils sonntags wird der Roman «Schneesturm im Hochsommer» auf zeitlupe.ch fortgesetzt.
- Weitere Kapitel können Sie hier lesen.
«Schneesturm im Sommer»
Meinrad Inglin ist einer der bekanntesten Unbekannten, seinen Namen kennen fast alle, seine Werke die wenigsten. Dabei ist er ein grosser Könner in einem grossen Spektrum unterschiedlicher literarischer Genres, stilistisch abwechslungsreich und sprachlich wohlkomponiert. «Schneesturm im Hochsommer» versucht, sein vielfältiges Schaffen abzubilden und damit einen literarisch hochinteressanten und oft überraschend aktuellen Schweizer Klassiker wieder breiter bekanntzumachen.
«Inglin ist seit Jahren genau der, von dem viele sagen, man hätte ihn ‹nicht auf dem Schirm› und der deshalb allen so präsent ist. Die Frage ist doch vielmehr: Was macht den Kerl so interessant, dass er nicht verschwindet? Er hat nie auf Effekt geschrieben. Er hat versucht, Verhältnisse zu beschreiben, wie sie sind. Eine Haltung, die nach dem ganzen postmodernen Klimbim auf eine neue Art interessant ist.»
Peter von Matt
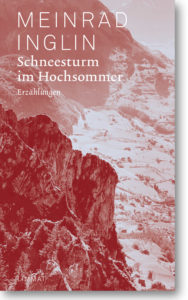
Meinrad Inglin, «Schneesturm im Hochsommer».
Herausgegeben von Ulrich Niederer, Nachwort von Usama Al Shahmani, 256 Seiten, Leinenband, CHF 28.– (UVP), Limmat Verlag, Zürich
Umschlagfotografie: Dino Reichmuth, Unsplash
Typografie und Umschlaggestaltung: Trix Krebs
Druck und Bindung: Friedrich Pustet, Regensburg
ISBN 978‑3‑03926‑021-8
© 2021 by Limmat Verlag, Zürich www.limmatverlag.ch
