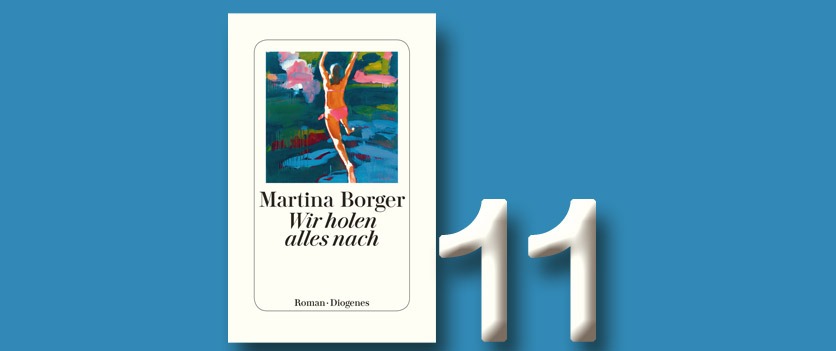
Wir holen alles nach, Kapitel 11 Von Martina Borger
Letzte Woche hat die Schule wieder angefangen, Ellens Ferien sind zu Ende. Ihre Tage sind wieder angefüllt, mit Zeitungaustragen, mit Nachhilfestunden, mit dem Unterricht bei den Afrikanerinnen.
Einerseits mag sie die klaren Strukturen, andererseits ist sie auch ein bisschen wehmütig, sie hat das Gefühl, die freien Wochen nicht ausreichend genutzt zu haben. Sie wollte öfter schwimmen gehen, wenigstens ein-, zweimal ins Open-Air-Kino, eine grössere Bergwanderung machen, mit Übernachtung auf einer Hütte. Hat sie alles nicht getan, nicht nur wegen Elvis, aber auch.
Jetzt kommt er wieder nur zweimal die Woche zur Nachhilfe. Sie freut sich immer, ihn zu sehen, denn was sie nicht erwartet hat: Sie vermisst seine tägliche Anwesenheit. Er war ein angenehmer Gast, ruhig, rücksichtsvoll, hilfsbereit, nicht eine Minute ist er ihr auf die Nerven gegangen. Und es war schön, jemanden zum Plaudern zu haben, eine Begleitung auf den Spaziergängen, einen Grund, sich ein schönes Essen auszudenken und dafür einzukaufen.
Sie hat es Vitus erzählt am Telefon, in dem leichten, halb amüsierten Tonfall, den sie ihm gegenüber immer anschlägt, wenn es um Persönliches geht. Er ist natürlich sofort darauf angesprungen. «Ich sag’s dir immer, Ma, du bist zu viel allein.»
Ellen weiss, dass ihre beiden Söhne sich diesbezüglich Sorgen um sie machen, dass es sie beruhigen würde, wenn sie wüssten, dass sie jemanden an ihrer Seite hätte, der Verantwortung übernehmen und im Notfall auch Hilfe leisten könnte, bei dem sie aufgehoben wäre. Es stimmt schon, früher hatte sie ein wesentlich reicheres soziales Leben. Mit Jock sowieso, er hatte einen grossen Freundeskreis, sie waren viel ausgegangen, trotz der kleinen Kinder. Oder sie waren bei ihnen zu Hause zusammengesessen, manchmal ein Dutzend Leute, bei Spaghetti und Bier, sie hatten geredet und gestritten und geflirtet, getrunken und gekifft, viel Musik gehört und zu fortgeschrittener Stunde manchmal getanzt.
Sie erinnert sich besonders gern an einen Abend, sie hatten spontan ein Quiz gemacht, in dem es um die Entstehungsjahre der Songs der Ramones ging. Jock hatte jede Zahl richtig und dafür viel Bewunderung eingeheimst. Als sie ins Bett gingen, hatte er ihr grinsend gebeichtet, dass er mit Hilfe von Henry, der den CD-Player bediente, beschissen hatte, Henry hatte ihm die Zahlen unauffällig durch Fingerzeichen verraten, keiner hatte etwas gemerkt. Und Jock hatte endlich mal Carlo, Miris damaligem Freund, einem elenden Besserwisser, eine Niederlage verpassen können, von guter Musik hatte der ja keine Ahnung. Sie hatten sehr gelacht.
Nach Jocks Tod waren die Kontakte weniger geworden, es war plötzlich deutlich stiller in der Wohnung, es gab zu viel Platz. Mit Jock hatte es Lärm und Bewegung und Unruhe gegeben, Fluchen und Lachen. Während er kochte, hatte er den Telefonhörer zwischen Schulter und Kinn geklemmt, und nebenbei deckte er noch den Tisch, meistens fiel dabei klappernd etwas herunter, sie konnte es noch drei Türen weiter hören.
«Fang nicht wieder an», sagt sie. «Du wirst mich eh nicht mehr ändern.»
Alle hatten ihr vorausgesagt, dass sie in ein Loch fallen würde, als die Jungs, beinahe gleichzeitig, aus dem Haus gingen, Vitus schon nach Köln und Benedikt nach Weihenstephan auf die Landwirtschaftschule, er wohnte in einer WG in Freising. Aber so war es nicht gekommen, ganz und gar nicht.
Am ersten Wochenende ohne die Jungs war Ellen verreist, sicherheitshalber, weil die Unkenrufe sie doch ein bisschen nervös gemacht hatten. Sie fuhr mit Miri und Henry, die beide ebenfalls der Unkenfraktion angehörten, nach Rom. Es war nett, aber irgendwie hing über den Tagen eine gewisse Bedrücktheit, als gebe es etwas zu betrauern. Ellen kaufte sich aus Trotz ein Paar knallrote Pumps, die Absätze für den Alltag eigentlich zu hoch, die sie aber trotzdem jahrelang trug.
Als sie am Sonntagabend bei ihrer Rückkehr die Wohnungstür aufschloss, war es ungewohnt still, nur das Ticken der Küchenuhr war zu hören. Sie ging in die Küche, die noch genauso aussah wie bei ihrer Abreise vor drei Tagen, kein dreckiges Geschirr in der Spüle, keine Brotkrümel auf dem Fussboden, der Kühlschrank noch genauso bestückt wie zuvor. Sie machte sich etwas zu essen, ohne dass gleich jemand in die Küche geschlurft kam und etwas abhaben wollte, sie setzte sich vor den Fernseher und sah einen Tatort, ohne dass neben ihr ein Klugscheisser schon nach zehn Minuten behauptete zu wissen, wer der Täter sei, während er das Sofa mit Chips vollkrümelte.
Niemand war da, der verlangte, um Punkt sieben geweckt zu werden, was erfahrungsgemäss bis mindestens zwanzig nach dauerte, keiner, der miesgelaunt darüber klagte, dass keine Butter im Haus war. Alle Dinge blieben an dem Platz, an dem sie selbst sie hingelegt hatte, und es kamen auch nicht, ganz zufällig, zwei, drei Jugendliche vorbei, die bloss mal hallo sagen wollten, um im Anschluss an die lässige Begrüssung den Kühlschrank leerzufressen; sie war längst darauf verfallen, Lebensmittel, die sie für sich behalten wollte, ganz hinten in einem Schrank zu bunkern, beim Suchen waren die Jungs nicht sonderlich findig. All das war jetzt nicht mehr nötig.
Sie wartete zur Sicherheit noch ein paar Tage ab, ob sich ihr Wohlgefühl verflüchtigen und doch einer gewissen Trauer oder zumindest Wehmut weichen würde, dass eine Phase ihres Lebens endgültig vorbei war, aber es geschah nicht. Natürlich freute sie sich immer über Vitus’ Anrufe oder darüber, dass Benedikt fast jedes Wochenende vorbeikam, meist auf dem Weg zu einer Party; sie kochte dann eins seiner Lieblingsgerichte oder sie gingen etwas essen, sie redeten, brachten einander auf den neuesten Stand, verabredeten auch mal einen gemeinsamen Kinobesuch, dann ging er wieder. Und sie war nicht traurig, sondern zufrieden, freute sich, dass es ihm gutging.
Damals begann sie auch, ihre Kontakte radikal zu reduzieren. Das Bedürfnis, Zeit für sich zu haben nach der Arbeit oder am Wochenende, war eindeutig grösser als die Lust, Bekanntschaften aufrechtzuerhalten, die sie ermüdend, langweilig oder auch einfach nervig fand. Mit zwei Freundinnen zerstritt sie sich aktiv, bei den anderen wurden die Lücken zwischen Telefonaten, Mails und Treffen mit der Zeit immer grösser, bis die Beziehung einschlief.
Anfangs hatte sie noch ein schlechtes Gewissen, es hatte ihr ja keiner etwas getan. Und es war ja auch nicht so, dass sie den anderen verabscheute, seine Gegenwart nicht mehr ertragen konnte – sie hatte einfach keine Lust. Und für ständiges Sich-Überwinden-Müssen war das Leben zu kurz. Sie hält es ohnehin für eine ganz normale Alterserscheinung, dass das Interesse an anderen Menschen generell abnimmt, dass man sich auf einige wenige konzentriert und auf sich selbst. Sie hat ihre Familie, wenn auch aus ihrer Generation ausser ihr niemand mehr am Leben ist, aber es gibt ihre Söhne, wenn auch nicht in unmittelbarer Nähe.
Sie hat Miri, zu der sie unverändert intensiven und innigen Kontakt hält, sie hat die ehemaligen Kolleginnen aus der Buchhandlung, die sie regelmässig sieht, sie hat ein, zwei engere Freundinnen, die allerdings nicht in München leben und mit denen sie alle paar Wochen telefoniert, und sie hat Henry. Sie wird immer noch eingeladen, zu Partys, Geburtstagen, Sommerfesten, meist geht sie hin, auch wenn es sie Überwindung kostet, weil sie die Zeit lieber für sich nutzen und den Abend mit einem Buch oder einem Film verbringen würde, anstatt sich in ihr Seidenkleid zu werfen und die Füsse in die Pumps zu zwängen, vom Schminken ganz zu schweigen.
«Wann bist du eigentlich so ein Misanthrop geworden?», hatte Vitus gefragt, beim letzten Treffen der ganzen Familie während der Weihnachtsfeiertage, Benedikt und Freja waren mit Valerie aus Skagen gekommen, Vitus und der damals gerade aktuelle Clemens aus Köln. «Oder gibt’s da auch eine weibliche Form? Misanthropin?»
Er hatte etwas Schwierigkeiten mit der Aussprache, sie hatten reichlich Bier und Wein intus und auch ein paar Schnäpse, Benedikt hatte sie in den «Augustiner» eingeladen.
«Wie auch immer es heisst, ich bin es nicht», hatte Ellen gesagt. «Ich mag Menschen. Euch zum Beispiel sehr.»
«Das zählt nicht. Seine Kinder hat man immer lieb, das ist Natur.»
Vitus trank sein Bier aus und winkte der Kellnerin, er hatte schon vier Halbe gehabt, würde aber sicher mindestens noch eins trinken, ihre beiden Söhne waren so trinkfest wie ihr Vater.
«Und ich mag Miri und Henry und all meine ganzen Kolleginnen und meine Nachhilfeschüler, die meisten jedenfalls. Soll ich dir jetzt noch jeden Menschen aufzählen, den ich je gut leiden konnte? Das dauert Stunden.»
«Wahrscheinlich», sagte Benedikt und legte den Arm um Freja, Valerie schlief schon längst auf der Bank neben ihnen, Benes Daunenjacke als Kopfkissen, «fängst du gleich noch mit Herrn Ranftl an. Das war unser Metzger, als wir noch in Pasing gewohnt haben.»
«Genau», Vitus lachte auf. «So ein kleiner, dicker. Er hat Mama regelrecht verehrt, sie war ja damals ein ganz schöner Feger. Sie kriegte immer das beste Fleisch von ihm, Rinderfilet zum Sonderpreis, er hat es extra für sie aus der Kühlung geholt. Beim Abschied hat er ihr immer zugezwinkert, so», er klimperte übertrieben mit den Wimpern.
«Und wir bekamen ein Würstchen», sagte Benedikt. »Und zwar jeder eins. Bei anderen Metzgern gab’s höchstens eine Scheibe Gelbwurst.»
«Er hat irgendwie komisch gesprochen, so durch die Nase», Vitus’ Winken Richtung Kellnerin wurde nachdrücklicher, er signalisierte ihr gestisch, dass sie noch drei Bier wollten, Clemens und Freja tranken Wein. «Und er hat total hochgestochen geredet, die Wörter aber falsch verwendet. Was hat er immer gesagt, wenn es seiner Frau nicht gutging, Bene?»
«Meine Gattin ist heute etwas krankhaft.»
Vitus wartete, bis das Gelächter sich gelegt hatte.
«Genau. Aber wir durften nie über ihn lästern. Mama hat’s verboten. Weil er ein guter Mensch war.»
«Das war er auch«, sagte Ellen.» Er war sehr sozial engagiert. Zu Weihnachten hat er den Obdachlosen unter den Isarbrücken grosse Pakete mit Essen gebracht. Und warme Kleider. Er hat vielen Leuten geholfen. Mir übrigens auch. Weil er wusste, dass wir nicht viel Geld hatten.»
«Ich glaub eher, er wollte dich in sein Bett locken mit Rindsrouladen und Fenchelsalami», sagte Vitus.
«Seine Frau war ja ziemlich hässlich.»
«Wieso unterstellst du dem armen Mann nur böse Absichten», hatte Ellen gesagt. «Wer ist jetzt hier der Misanthrop?»
Sie hat Menschen inzwischen einfach lieber einzeln, viele auf einmal kann sie nicht mehr gut ertragen. Sie meidet die Innenstadt, in die sie höchstens ein-, zweimal im Jahr fährt, wenn sie etwas braucht, was es in ihrem Viertel nicht gibt, sie hasst diese drängeln- den und schiebenden, mit Einkaufstüten beladenen Menschenmassen, alle auf der Suche nach zumeist Überflüssigem, nach Schnäppchen, nach billigen, in Drittweltländern hergestellten Klamotten, die nach ein paarmal Tragen in die Kleidercontainer wandern.
Keine zehn Pferde würden sie inzwischen mehr in ein Wiesn-Zelt kriegen; als Jock noch lebte, waren sie jedes Jahr mehrmals da, mit einer grossen Clique, Henry hatte gute Beziehungen zu einer hübschen Kellnerin. Jetzt macht Ellen mit Miri einmal während der Zeit einen Wiesn-Bummel, an einem Werktagmittag, wenn es noch relativ leer ist. Sie essen ein Hendl trinken jede so viel, wie sie von ihrer Mass runterbekommen, und laufen dann mit einer grossen Tüte gebrannter Mandeln zu den Fahrgeschäften, bei denen es am meisten zu lachen gibt, vorzugsweise Haut den Lukas oder den Toboggan, auf dessen Förderband die Betrunkenen ins Straucheln kommen. Ein grosser Spass, noch dazu kostenlos.
Sie geht auch nicht mehr auf Demos, sie ist einfach empfindlicher geworden gegen Gedränge und Lärm. Fast allen Leuten ihres Alters geht das so, mehr oder weniger. Sie kann sich kaum noch vorstellen, wie sie es früher ausgehalten hat, all die Konzerte, Open-Air-Festivals, Kindergeburtstage, Spielplätze. Hat sie damals unter dem Krach gelitten, ihn überhaupt wahrgenommen? Sie kann sich nicht mehr erinnern.
Inzwischen ist Stille für sie kostbar geworden. Und sie geniesst ganz bewusst die Momente der Ruhe, die sie dem lauten Stadtleben abtrotzen kann, beim frühmorgendlichen Zeitungsaustragen zum Beispiel oder beim Spazierengehen an einem Werktagmorgen in einem abgelegenen Gelände, wenn sie höchstens ab und zu einem anderen Hundebesitzer begegnet.
Vor einer Weile hat sie über Luxusgüter gelesen, die man mit Geld nicht oder nur eingeschränkt kaufen kann: sauberes Wasser. Gesundheit. Ein weitgehend stressfreies Leben. Freie Zeit, gute Luft und Ruhe eben. Alle diese Dinge hat sie. Zumindest noch. Sie ist privilegiert.
Was bisher geschah:
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Martina Borger
Wurde 1956 geboren und arbeitete als Journalistin, Dramaturgin und Filmkritikerin, bevor sie sich aufs Drehbuchschreiben verlegte. Sie hat bei mehreren Serien als Storylinerin und Chef-Autorin gearbeitet. Gemeinsam mit Maria Elisabeth Straub veröffentlichte sie 2001 ihren ersten Roman «Katzenzungen», dem «Kleine Schwester» (2002), «Im Gehege» (2004) und «Sommer mit Emma» (2009) folgten. Ohne Co-Autorin erschien 2007 ihr Roman «Lieber Luca». Martina Borger lebt in München.
Martina Borger, «Wir holen alles nach», Roman, Diogenes
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2020 Diogenes Verlag AG, Zürich, www.diogenes.ch
120 / 20 / 44 / 1; ISBN 978 3 257 07130 6