
Wenn der eigene Vater an Demenz erkrankt
Was tun, wenn die Eltern pflegebedürftig werden? Sie daheim umsorgen statt in ein Heim zu geben? Der deutsche Autor Volker Kitz stand vor dieser Entscheidung – und hielt in einem berührenden Buch fest, was das für ihn bedeutete und wie er die letzten Jahre mit seinem Vater erlebt hat.
Text: Marco Hirt
«Ich bekam kalte Füsse. Meine Füsse waren so kalt, dass ich sie nicht spürte, als stünde ich mit dem Becken auf dem Boden.» So beschreibt Volker Kitz in seinem Buch «Alte Eltern» den Moment, als er im Spital nach der Patientienverfügung seines Vaters gefragt wurde. Wegen einer Blasenverletzung hatte dieser viel Blut verloren, lebensrettende Massnahmen waren notwendig. Doch der Sohn unterschlug das Dokument. «Ich habe Angst bekommen, das Falsche zu tun, war überfordert in der Notfallaufnahme.» Sein Vater bekam eine Blutkonserve, sein Herz blieb nicht stehen, und er lebte noch ein Jahr. Wobei Volker Kitz dann erneut in dieselbe Situation kam – diesmal war es eine Lungenentzündung. «Nicht jetzt, dachte ich, ich kann ihn jetzt nicht sterben lassen, ausgerechnet, wenn ich nicht bei ihm bin.» Angekommen im Spital verheimlichte er die Patientenverfügung aber kein zweites Mal.
«Wie hat es angefangen?»
Ein Loslassen, das schon länger zuvor seinen Anfang nahm: Denn die letzten Jahre seines Vaters, der Anfang 2024 mit 79 starb, waren von dessen Demenzerkrankung überschattet. Und von dieser Zeit schreibt Volker Kitz in «Alte Eltern». «Wie hat es angefangen?», habe er sich gefragt. «Was haben mein Bruder und ich nicht gesehen? Nicht sehen wollen? Was haben wir verdrängt?» Seit dem Unfalltod seiner Mutter 2004 lebte der Vater allein, 700 Kilometer von Volkers Wohnort Berlin entfernt, was lange gut ging. Dann mehrten sich die Anzeichen einer Veränderung. Zum Beispiel eine Vielzahl von Zetteln im ganzen Haus, auf die der Vater sich Notizen machte, den minutiösen Tagesablauf, den er auf einem Schreibblock festhielt: Für den Sohn schien es wie eine Marotte, für den Arzt war es ein Zeichen dafür, die Kontrolle über sein Leben nicht verlieren zu wollen. «Demenzielles Syndrom» lautete die Diagnose. Und zunehmend konnte der Vater seinen Alltag nicht mehr selbst bewältigen.
Volker Kitz entschied, ihn in einem Pflegeheim in Berlin unterzubringen, ganz in der Nähe seiner Wohnung. Statt zu ihm zu ziehen und ihn in seinem Daheim zu pflegen. «Es ist mir schwergefallen, aber ich hätte mein Leben aufgeben müssen», erklärt der Schriftsteller. Sein Vater wäre aufgrund der fortgeschrittenen Demenz zudem auch ständig zu beaufsichtigen gewesen. »Ich habe versucht, dies zu kompensieren, indem ich ihn alle ein, zwei Tage für einige Stunden besucht habe. Letztlich muss jedes Kind selbst entscheiden, zu was es sich verpflichtet fühlt. Die Antwort hängt vom Verhältnis ab.» Hätte er einen Rabenvater gehabt, überlegt Kitz, wäre die Bindung an den Vater nicht so stark und vielleicht vieles leichter gewesen.
«Elementare Handlungen waren nicht mehr möglich»
Er verbringt bis zu dessen Tod soviel Zeit wie möglich mit ihm. «Das Gefühl, nicht genug zu tun oder getan zu haben, bin ich nicht ganz losgeworden.» Sie machen lange Spaziergänge, bis zu zwei Stunden. «Mein Vater war noch sehr mobil. Was aber nicht mehr funktionierte, war zum Beispiel eine Tür zu öffnen, weil er die Türklinke nicht mehr bedienen konnte. Elementare Handlungen waren nicht mehr möglich. Oder er hat die Stehlampe mit ins Bett genommen, die Erde der Zimmerpflanze gegessen. Er war nicht einfach nur vergesslich.» Das sei auch das Schwierige gewesen – dass man sich die Auswirkungen der Krankheit schlecht vorstellen könne. «Ich hatte Zeit für ihn eingeplant und Kraft. Ich hatte aber nicht damit gerechnet, wie schwer es ist, die Veränderungen und Schübe mitanzusehen, was plötzlich alles nicht mehr geht.» Die Diagnose zu akzeptieren sei das eine, die unabänderliche Verschlechterung anzunehmen das andere. «Das Morgen ist anders als das Gestern. Ich aber wollte immer zum früheren Zustand zurück und musste mich davon lösen.»
«Zu merken, man ist nicht allein, ist eine grosse Hilfe»
«Alte Eltern» sei kein Ratgeber, sondern eine Erzählung, in der er Gedanken reflektiere. Begonnen hat es damit, als er einfach mitgeschrieben habe, um die Situation zu verarbeiten. Und was lose anfing, wurde ein Buch. «Ich habe festgestellt, dass viele Menschen dieselben Dinge erleben, wie sie meinem Vater und mir passiert sind. Einfach eine andere Geschichte zu lesen und zu merken, man ist nicht allein, das ist zumindest für mich eine sehr grosse Hilfe im Leben.»
Gut zu wissen
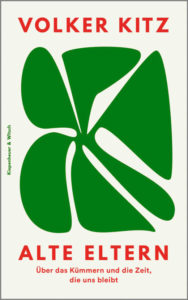 Er habe seinem Vater gesagt, dass er ein Buch schreiben möchte – in dem es um ihn gehe. «Er hatte da einen lichten Moment und genau zugehört, mich mit grossen Augen angeschaut», erinnert sich Volker Kitz. Er finde es eine gute Idee, das interessiere die Leute bestimmt. «Dann hat er eine Moment überlegt und ergänzt, dass es aber nicht zu persönlich sein dürfe, sonst interessiere es die Leute doch wieder nicht.» So habe er das grundsätzliche Einverständnis bekommen, aber immer von Neuem entscheiden müssen, was zu persönlich ist. «Das war nicht so einfach, da der Text im Schreibprozess immer persönlicher wurde. Da ich bei der Recherche aber gemerkt habe, dass das von uns Erlebte kein Einzelfall ist, konnte ich die Latte immer höherlegen, wie persönlich ich schreiben darf, dass es dem Willen meines Vaters entspricht.»
Er habe seinem Vater gesagt, dass er ein Buch schreiben möchte – in dem es um ihn gehe. «Er hatte da einen lichten Moment und genau zugehört, mich mit grossen Augen angeschaut», erinnert sich Volker Kitz. Er finde es eine gute Idee, das interessiere die Leute bestimmt. «Dann hat er eine Moment überlegt und ergänzt, dass es aber nicht zu persönlich sein dürfe, sonst interessiere es die Leute doch wieder nicht.» So habe er das grundsätzliche Einverständnis bekommen, aber immer von Neuem entscheiden müssen, was zu persönlich ist. «Das war nicht so einfach, da der Text im Schreibprozess immer persönlicher wurde. Da ich bei der Recherche aber gemerkt habe, dass das von uns Erlebte kein Einzelfall ist, konnte ich die Latte immer höherlegen, wie persönlich ich schreiben darf, dass es dem Willen meines Vaters entspricht.»
Volker Kitz: «Alte Eltern. Über das Kümmern und die Zeit, die uns bleibt» (240 Seiten, Kiepenheuer & Witsch, ca. CHF 34.90)



