
Die entzauberte Insel (Kapitel 1.1) Aus «Schneesturm im Hochsommer»
Am Rande des Inselgehölzes, unter verwachsenen wilden Laubbäumen, von denen ein paar Äste fast bis auf das Wasser herabhingen, schob sich ein junges Gesicht durch das niedere Gesträuch, ein nackter Arm folgte behutsam und stützte sich auf einen bemoosten Block des schmalen felsigen Ufers. Eine Wasserjungfer hielt in der Luft vor dem Gesichte zitternd an und flitzte wieder weg. Der Jüngling schaute in eine Lücke des dünnen Schilfgürtels hinein auf frisch erblühte weisse Seerosen und spähend in das klare Wasser hinab. Er sah dort unten zwischen den langen weichen Blattstengeln und weiter draussen gegen den abfallenden Grund einen Schwarm fremdartiger Fische; sie glichen grossen, auf der Kante ruhenden Silberhänden, und es kam ihm geheimnisvoll vor, wie sie, gegen Osten gerichtet, unter den Seerosen und ihren schwimmenden grünen Blättern in verschiedener Tiefe regungslos verharrten. Nach einer Weile blickte er auf und sah draussen den See im heissen Sonnenlichte flimmern, während dieser Uferstreifen im Schatten lag, er sah das grüne Dach der überhängenden Äste, die schneeweissen Blüten auf dem klaren Wasser, darunter wieder die ruhenden Fische, und er begann mit seinem stillen Gesichte wie in einem wunderbaren Traum erstaunt und glücklich zu lächeln.
Ein Anruf weckte ihn. «Baschi, Baschi!», rief eine jugendliche Stimme, und damit war er gemeint, er hiess Sebastian. Langsam kroch er zurück, stand auf und ging in seiner verwaschenen roten Badehose durch das Unterholz des Inselwäldchens an das gegenüberliegende Ufer. Dort hatten seine drei Kameraden, mit denen er gelandet war, das entliehene, geräumige Stehruderboot des alten Fischers in einer Felsnische festgebunden und machten am Ufer unter Tannen und Buchen ihre Angelruten bereit. Sie fragten ihn, wo er die Würmer verstaut habe. Er gab flüchtig Antwort, teilte ihnen aufgeregt seine Entdeckung mit und griff nach seiner Angelrute.
Da bekamen sie glänzende Augen vor Unternehmungslust und beeilten sich mit ihren Vorbereitungen. Sie waren sechzehn Jahre alt, Lateinschüler, die manchen freien Nachmittag fischend oder badend auf dieser einsamen Insel verbrachten, in einem heiteren Frieden, den sie vor allen Schulsorgen, vor Gewissensängsten, Weltanschauungsfragen und anderen Gespenstern bewahrten. Sie erlitten, wie ihre brüchigen Stimmen, den schwierigen Wechsel, der sie aus Knaben zu jungen Männern machte; hier fanden sie, ohne es recht zu wissen, als Knaben eine letzte Zuflucht und widerstanden auch meistens der eitlen Versuchung, sich untereinander wie Erwachsene zu benehmen. Während sie mit geübten Fingern den Angelhaken in den Regenwurm steckten, meinte der naturkundige Anselm, dass Baschi wahrscheinlich Brachsen gesehen habe, schöne, aber hier nicht eben seltene Fische.
«Ganz klar!», sagte Karl, ein stämmiger, lebhafter kleiner Bursche, dem alles schlüssig über die Zunge kam und dessen Stimmbruch auch am weitesten fortgeschritten war. «Übrigens sind sämtliche Fische in diesem See so genau bekannt, dass von fremdartigen keine Rede sein kann. Und nach deiner Beschreibung, Baschi, können es nur Brachsen sein …»
Robert, ein hübscher, kräftiger Junge in einer keilförmigen, knallroten Badehose, die an seinem wohlgenährten Körper etwas spärlich aussah, schloss die Beratung recht einfach: «Brachsen oder nicht, wenn wir sie nur erwischen. Los!»
Sie gingen, ihre Angelruten hochhaltend, durch das Gestrüpp zum Schattenufer, wo Robert, Karl und Anselm erregt flüsternd ihre Schnüre dicht nebeneinander vorsichtig zwischen die Seerosen hinabgleiten liessen.
Für Sebastian war kein Platz mehr, und er drängte sich nicht hinzu, er hatte die Fische entdeckt und als Erster betrachtet, das genügte ihm, mochten nun die andern die Entdeckung nützen. So ging es ihm oft, und er fand sich damit ab, ja er ahnte auch schon, dass mit diesem Los in Zukunft höhere Dinge zu erwerben waren als die handgreiflichen, die etwa Robert im Sinn hatte. Er war ein tiefgründiger, schüchterner Bursche, der neben seinen nur zum Teil geliebten Schulfächern Gedichte las und geigen lernte, indes die andern sich vorläufig mit Indianergeschichten begnügten. Hier aber lebte er wie seine Kameraden und mit ihnen übereinstimmend, froh, unbefangen und noch ohne Richtung. Er trug die Angelrute an den Platz zurück, den sie Schifflände nannten, und streifte zu seinem Vergnügen ein wenig herum.
Der See mit seinen stillen, von Schilf, Ried und Wald begrenzten, von Bergen hoch umgebenen Ufern glänzte im frühsommerlichen Nachmittagslichte. Die Insel lag dem westlichen Waldufer gegenüber auf einer Klippe, einem unregelmässig aus dem Wasser ragenden Felskopf, den seit Menschengedenken eine kleine Wildnis bedeckte. Sie war nicht grösser als ein mittlerer Dorfplatz, aber voll heimlicher Winkel und Schlüpfe. Sebastian stieg auf eine von jungen Tannen, Kiefern und Stechpalmen bewachsene Kuppe und drüben zu einer Uferstelle hinab, wo zwischen bemoosten Blöcken eine Wildente im Mai zwölf Eier ausgebrütet hatte. Er fand im weich gepolsterten Nest noch Reste der Eierschalen und flaumige Federchen, von denen er sich einige hinter die Ohren steckte. Er kletterte dem Ufer entlang zur Eglibucht und sah einem kleinen Barsch zu, der schwänzelnd halbwegs auf dem Kopfe stand und sein Maul heftig in den kiesigen Grund stiess, dann drang er zwischen Weiden- und Haselbüschen wieder ins Innere, wo Buchen, Eschen, Eichen verschiedenen Alters sich gegenseitig in die Kronen gerieten, und trat zuletzt auf eine sonnige Ufernase hinaus, die sie Hechtekap nannten. Sie fiel mit goldgelb blühendem Ginster schräg ins Wasser hinab; ihr war auf Schritteslänge eine kleine Felsbank vorgelagert, die sich knapp über die Oberfläche erhob. Mit einem weiteren Schritt über das untiefe Wasser erreichte man einen kahlen Buckel, der zu dieser Jahreszeit schon bei leichtem Wellenschlag überspült wurde, aber jetzt zwei Füssen eben noch trockenen Stand gewährte. Diesen Buckel betrat Sebastian, reckte sich in der strahlenden Sonne, blickte auf den See hinaus und blieb da stehen.
Indessen spähten die Übrigen zu den Fischen hinab, die nicht anbeissen wollten. Es waren junge Brachsen, im Vergleich zu gewissen fingerlangen Beutestücken schon recht ansehnliche und daher begehrte Fische, obwohl man ihrer vielen groben Gräten wegen zu Hause die Nase rümpfte, wenn die jungen Fischer grossartig mit einem pfündigen Muster davon anrückten. Robert wurde ungeduldig und erklärte, wenn keiner dieser offenbar schon vollen Fresssäcke anbeissen wolle, so werde er auf andere Art dennoch einen erwischen. Er versuchte nun mit dem leeren Angelhaken einen der Brachsen am Bauche anzureissen.
Anselm runzelte die Stirn. «Hör auf!», rief er. «Das ist nichts, das ist keine Fischerei! Ausserdem verscheuchst du sie nur … da, bitte, da ziehen sie ab, kannst ihnen jetzt nachsehen, du Oberfischer!»
Anselm, ein schlanker, sehniger Junge in blauer Badehose, war sehr darauf bedacht, dass mit den Fischen, mit den Tieren überhaupt, keine Schindluderei getrieben wurde, und er duldete zum Beispiel nicht, dass man zwecklos, nur so zum Vergnügen, kleine Fische fing, um sie nachher wegzuwerfen. Er hatte ein längliches Gesicht mit klugen, dunklen Augen, die ausnahmsweise sowohl vor Heiterkeit wie vor Entrüstung sprühen konnten, aber sonst mit einem freundlichen Ernst ins Leben blickten und eine Art verrieten, der man nichts Unedles zutraute. Er verurteilte das unsportliche Benehmen Roberts, doch ihn selber mochte er aus anderen Gründen wieder gut leiden und nahm ihm seinen Verstoss jetzt auch nicht übel, wie denn auf dieser Insel überhaupt nichts übel oder schwer genommen und auch kein triftiger Anlass dazu geboten wurde.
Sie gingen auf andere Plätze, fingen ein paar Gründlinge und kleine Barsche, die sie als Köder an dreifache Angeln steckten, und verteilten sich gespannt zum Hechtfang. Als sich auch dabei vorläufig nichts ereignete, «setzte» jeder die Angelrute, indem er ihre Mitte auf einen Steinblock oder eine Astgabel legte, ihren Schaft in ein Loch steckte oder mit Steinen beschwerte; geduldig stand er dann da, beobachtete den unruhigen Korkschwimmer und ergriff die Rute nur noch, um das ängstlich zum Ufer strebende Köderfischchen behutsam wieder ins tiefere Wasser hinauszuschwingen.
Eine Stunde lang war es still auf der Insel, die Baumkronen standen regungslos im wärmeren Lichte des vorrückenden Nachmittags, ihre Schatten auf dem ruhigen Wasser verschoben sich unmerklich, und im vielfältigen Grün des Ufergehölzes schimmerte da und dort der helle Körper eines jugendlichen Fischers. Ein langschnabliger, wunderbar bunter Vogel, der unversehens aus den Bäumen flog und die Insel umkreiste, brachte wieder alle in Bewegung. Anselm kam hastig dem Ufer entlang zu Sebastian, der, in die laubigen Äste spähend, seinen Platz eben auch verliess, und rief gedämpft: «Ein Eisvogel, ein Königsfischer!» Sebastian hatte ihn gesehen, wie er vom Ufer wieder unter die Bäume geflogen war, sie gingen ihm nach und trafen Karl und Robert, die ihnen wie aus einem Munde zuriefen: «Habt ihr den Eisvogel gesehen?» Sie alle hatten ihn gesehen, einen kleinen rotfüssigen Vogel mit blaugebändertem Nacken, bläulichgrün schillernden Flügeln und seidig glänzender rostroter Brust, und sie zerstreuten sich suchend, um ihn noch einmal vor Augen zu bekommen, doch er war und blieb verschwunden wie im Traum ein flüchtiger schöner Gedanke.
Zum Autor
Meinrad Inglin (1893–1971) Sohn eines Goldschmieds, Uhrmachers und Jägers, wurde mit siebzehn Jahren Vollwaise. Uhrmacher- und Kellnerausbildung, trotz fehlender Matura Studium der Literaturgeschichte und Psychologie in Bern, Genf und Neuenburg. Tätigkeit als Zeitungsredaktor, während des Ersten und Zweiten Weltkriegs Offizier im Grenzdienst. 1922 als Journalist in Berlin, danach als freier Schriftsteller in Schwyz. Für sein Werk (vor allem Romane und Erzählungen, einzelne Aufsätze, Notizen und eine Komödie) wurde Inglin vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Grossen Schillerpreis und dem Gottfried-Keller-Preis.
Sie trafen sich wieder und stellten fest, dass heute das Wetter zum Fischen nicht günstig sei. Keiner hatte etwas gefangen. Das verdross sie nicht, sie zogen die Angelruten ein, stiegen ins Wasser und schwammen voller Wohlgefühl herum, bis die Schattenspitze des waldigen Abendberges die Insel streifte, dann brachen sie auf.
Am nächsten freien Nachmittag betraten sie die Insel abermals, gespannt und neugierig wie je, da hier kein Nachmittag ganz dem andern glich. Karl fing denn auch im Verlauf einer Stunde mit Gründlingen zwei viertelpfündige Barsche, worauf alle den Barschen nachstellen wollten und den bewölkten Himmel priesen, der baldigen Regen verhiess. Während sie nun zwischen ihren Fangplätzen und der Schifflände, wo ein Kessel mit Gründlingen und eine Wurmbüchse standen, geschäftig hin und her gingen, kam aber Anselm, Schweigen gebietend, mit erhobenen Brauen und geheimnisvoller Miene aus einem Ufergebüsch und winkte ihnen. «Die Alte kommt», flüsterte er. «Die Schlange.» Sie folgten ihm leise ans westliche Ufer und spähten stumm aus dem Unterholz.
Eine Schlange schwamm auf die Insel zu; den dunklen Kopf über das Wasser erhoben, doch mit den Windungen des geschmeidigen Leibes kaum einmal die Oberfläche berührend, nahte sie rasch und unauffällig. Sie züngelte, als sie landete, man sah ihre gespaltene, fadendünne Zunge und ihre gelben Backenflecken, dann tauchte lang wie ein Menschenarm ihr schwarzgefleckter graubrauner Rücken auf; sie kroch, eine feuchte Spur hinterlassend, über eine schräge Steinplatte und verschwand am Ufer. Es war eine Ringelnatter, die Jünglinge kannten sie und empfanden keinen Abscheu, sie alle hatten schon Nattern aufgehoben, wenn auch nicht ohne einen geheimen leisen Schauder; sie waren übereingekommen, diese alte Schlange, die schon vor ihnen die Insel besucht, ja zu ihr gehört und Unberufene ferngehalten hatte, zu dulden und auch dann nicht zu stören, wenn sie sich nach ihrer Gewohnheit auf den warmen Steinen eines Fangplatzes sonnte. Am Anfang hatten sie freilich noch geschwankt, ob sie die Natter töten wollten oder nicht, dann war dank Anselms Fürsprache und gewissen rätselhaften Andeutungen Sebastians in ihrem unentschieden dämmernden Innern eine achtungsvolle Scheu erwacht, die Scheu vor dem Unheimlichen, Abgründigen, das sie als etwas Wirkliches wenigstens ahnten, obwohl sie nichts darüber aussagen konnten, und für das sie die Schlange heimlich als naturgegebenes Zeichen anzusehen begannen. Sie forschten jetzt nicht nach, wohin sie verschwunden war, sie gingen leise an ihre Plätze zurück, fischten ruhig weiter, ruhiger als vorher, als ob nun sie geduldet würden, doch heiter wie immer, und ruderten am Ende still von dannen.
Oft fuhren auch nur ihrer zwei oder drei zur Insel, manchmal aber kamen wieder andere Eingeweihte mit, Xaver zum Beispiel, ihr ältester Klassenkamerad, siebzehnjährig, ihnen allen ein wenig überlegen um die Erfahrungen dieses einen, entscheidungsreichen siebzehnten Jahres, und dann benützten sie neben dem alten Fischerkahn noch ein kleines Ruderboot.
Als endlich mit heissem Glanz und grell durchblitzten schwülen Nächten ihr Feriensommer anbrach, betraten sie die Uferklippe schon eines frühen Morgens hochbeglückt wie Entdecker ein märchenhaftes Eiland. Anselm schwang als Erster auf der Felsbank des Hechtekaps den kleinen Barsch an der Dreiangel hinaus, und kaum hatte der Korkschwimmer die vom Frühwind gekräuselte Wasserfläche berührt, als zum freudigen Schreck des Fischers jäh in die Tiefe fuhr. Karl und Robert rannten auf Anselms Ruf herbei und erkannten beim ersten Blick auf die Schnur erregt, dass ein Fisch gebissen hatte. «Warten, warten!», rief Karl. «Nur nicht zu früh ziehen! Gib Schnur!» Anselm tat dies gespannt und schweigend schon selber, er bedurfte keiner Ratschläge. Sie alle hatten als Anfänger erfahren, dass man höchstens die leere Angel aus dem Wasser riss, wenn man zu früh anzog, und sie wussten jetzt, dass der Hecht mit dem lebenden Köder in eine gewisse Tiefe fuhr, nachdem er ihn gepackt hatte, um ihn erst dort unten zu verschlingen. Sie waren nur nicht einig, wie lang man warten müsse, der eine zählte klopfenden Herzens auf zehn, der andere auf fünfzehn oder gar auf zwanzig. «Jetzt!», rief Karl. «Zieh!» Anselm hörte nicht auf ihn, er rollte zuerst noch ein Stück lose Schnur auf, dann aber, während Robert schon draussen auf dem Felsbuckel kauerte um die Beute in Empfang zu nehmen, dann riss er mit einem Ruck an, und die Rutenspitze bog sich so, dass die drei Fischer in Rufe des Erstaunens ausbrachen und die Grösse des Gefangenen bewunderten, eh sie ihn sahen. Anselm zog mit gestraffter Schnur und gebogener Rute den Fisch behutsam und stetig heran, und alle erwarteten atemlos sein Auftauchen; er tauchte auf, verblüfft, wie es schien, ohne Widerstand, ein grosser Fisch, ein Hecht. Erst als Robert nach ihm griff, schlug er mit dem Schwanze kräftig aus. Robert fuhr ihm mit der Rechten wie mit einem Raubvogelfang ins Genick und drückte ihm Daumen und Zeigefinger in die Kiemenspalten; er packte ihn so, dass er beim wildesten Zappeln nicht mehr entschlüpfen konnte, und es war zu erwarten, dass dieser entschlossene Junge dereinst auch im Leben nicht anders zupacken würde. Er hob ihn hoch empor und trug ihn lachend ans Ufer. Karl öffnete dem Räuber das scharf bezahnte weite Maul, und Anselm löste ihm die Angel aus dem Schlund, dann stellten sie Gewichtsschätzungen an, die zwischen zwei und drei Pfund schwankten, trugen ihn zum Fischkasten ins Boot und brachen sogleich zu neuen Taten auf.
Sebastian und Xaver beugten sich über den Fischkasten und betrachteten den Hecht. «Er hat ein Gesicht wie ein böser alter Wucherer», sagte Sebastian. «Ich habe einen abgebildet gesehen mit flachem Schädel, tückischen Augen und grämlich vorgeschobener Unterlippe, der hatte diesen Ausdruck.»
«Jawohl, das gibt’s auch im Leben», stimmte Xaver zu. «Leute, die so aussehen, sollte man angeln dürfen; die würden auf jeden Dreck anbeissen.»
Sie schlenderten lachend weg.
Ein blauer Sommermorgen strahlte über dem See, auf der Insel war es still, an ihren laubgrünen, bemoosten und steingrauen Ufersäumen stand da und dort ein ruhig fischender Jüngling, oder einer trat aus dem Schatten der Bäume ins Licht und leuchtete auf, ein anderer wandelte im Innern herum, und es schimmerte von ihm aus Gebüschlücken wie aus der Tiefe des Waldes von Spänen frischgeschälter Stämme. Sie fischten geduldig, wechselten manchmal ihre Plätze und blieben heiter und glücklich, obwohl sie nichts mehr fingen. Um Mittag schwammen sie in den See hinaus, alle in derselben Richtung und leise, um keine Fische zu stören, dann machten sie bei der Schifflände ein Feuerchen, brieten Käse, bähten Brot und kochten Tee, nachmittags fischten sie wieder oder taten nichts, und abends, später als sonst, ruderten sie still von dannen. Hinter ihnen glühte der Abendhimmel gewaltig auf, glühte sie an und glühte goldrot aus dem Wasserspiegel wider, zwei Reiher flogen über sie hin, und vom östlichen Berghang blitzten wie grosse feurige Sterne die Fensterscheiben menschlicher Wohnungen. Sie ruderten dem Ufer zu, wo sie ihre Kleider geborgen hatten, zufrieden mit dem Tag und freudig schon den nächsten bedenkend, in einem tieferen Frieden, als sie bei ihrer Unkenntnis der lauten Welt ermessen konnten, und durch ihre ungebrochene Jugend noch in einem letzten Einklang damit.
- Jeweils sonntags wird der Roman «Schneesturm im Hochsommer» auf zeitlupe.ch fortgesetzt.
- Weitere Kapitel können Sie hier lesen.
- Die «Editorische Notiz» zum Buch finden Sie hier.
«Schneesturm im Hochsommer»
Meinrad Inglin ist einer der bekanntesten Unbekannten, seinen Namen kennen fast alle, seine Werke die wenigsten. Dabei ist er ein grosser Könner in einem grossen Spektrum unterschiedlicher literarischer Genres, stilistisch abwechslungsreich und sprachlich wohlkomponiert. «Schneesturm im Hochsommer» versucht, sein vielfältiges Schaffen abzubilden und damit einen literarisch hochinteressanten und oft überraschend aktuellen Schweizer Klassiker wieder breiter bekanntzumachen.
«Inglin ist seit Jahren genau der, von dem viele sagen, man hätte ihn ‹nicht auf dem Schirm› und der deshalb allen so präsent ist. Die Frage ist doch vielmehr: Was macht den Kerl so interessant, dass er nicht verschwindet? Er hat nie auf Effekt geschrieben. Er hat versucht, Verhältnisse zu beschreiben, wie sie sind. Eine Haltung, die nach dem ganzen postmodernen Klimbim auf eine neue Art interessant ist.»
Peter von Matt
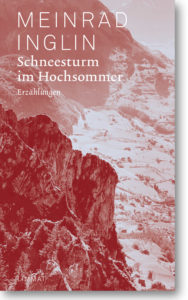
Meinrad Inglin, «Schneesturm im Hochsommer».
Herausgegeben von Ulrich Niederer, Nachwort von Usama Al Shahmani, 256 Seiten, Leinenband, CHF 28.– (UVP), Limmat Verlag, Zürich
Umschlagfotografie: Dino Reichmuth, Unsplash
Typografie und Umschlaggestaltung: Trix Krebs
Druck und Bindung: Friedrich Pustet, Regensburg
ISBN 978‑3‑03926‑021-8
© 2021 by Limmat Verlag, Zürich www.limmatverlag.ch
