«Eigenlob ist mir unheimlich»
Warum wäre die Videokünstlerin Pipilotti Rist beinahe Polizistin geworden? Wieso fühlt sie sich manchmal wie ein Adlerküken? Und was hat das alles mit ihrem abenteuerlichen Vornamen zu tun? Ein Atelierbesuch in Rists kunterbuntem Reich.
Interview: Claudia Senn; Fotos: Antonino Panté
Wer glaubt, Künstlerateliers seien wilde, chaotische Orte, wo eher durch Zufall als durch harte Knochenarbeit Kunst entsteht, wird bei Pipilotti Rist eines Besseren belehrt. Zwar wirkt ihr 500 Quadratmeter grosses Reich im Keller eines Bürogebäudes tatsächlich wie eine Villa Kunterbunt voller Bilder, Kunstwerke, Trash und Trödel. Doch chaotisch ist hier gar nichts. Rists Kunstproduktion ist ein straff organisiertes KMU mit acht Angestellten, darunter eine Programmiererin, eine Buchhalterin und ein ehemaliger Lehrer, der zwei Tage pro Woche Ordnung und Systematik in die unzähligen Computer und Projektoren, die alten und neuen Kunstwerke, Modelle, Fotos, Requisiten, Sachen und Sächelchen bringt.
Neben der Malerin Miriam Cahn ist Pipilotti Rist die bekannteste Gegenwartskünstlerin der Schweiz. Ihre Videoinstallationen werden in den grössten Museen der Welt gezeigt: dem M+ in Hongkong, dem Museum of Modern Art in New York, dem National Museum of Contemporary Art in Kyoto. Ihr «Pixelwald», eine Installation aus Tausenden bunt leuchtender LEDs, gehört zu den Highlights im Zürcher Kunsthaus und bezaubert dort Kinder genauso wie Erwachsene.
Mit Interviews meldet sich Pipilotti Rist nur selten zu Wort, und wenn doch, so immer im Auftrag ihrer Kunst. Diesen Sommer ist sie 60 geworden. Wie schaut sie auf ihr Leben und ihre Karriere zurück? Verlief ihr Werdegang tatsächlich so glatt und reibungslos, wie es von aussen den Anschein hat? Das wollen wir von der Künstlerin wissen. Im Gespräch wirkt sie stiller und nachdenklicher, aber auch zugänglicher, als wir es erwartet haben. Wie eine um genügend Vitamine besorgte Mama bewirtet sie ihren Gast mit Apfelschnitzen.
Pipilotti Rist, eigentlich heissen Sie mit Vornamen ganz konventionell Elisabeth Charlotte. Nennen Sie sich Pipilotti, weil Sie gerne verwegener, unerschrockener, Pippi-Langstrumpf-hafter wären?
Natürlich. Pipilotti zu heissen ist wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Von Natur aus bin ich eher verträumt und ängstlich, wie ein Adlerküken, das man ab und zu aus dem Nest schubsen muss. Mit diesem Vornamen habe ich keine Ausrede mehr. Ich brocke mir andauernd Zeug ein, das ich dann auslöffeln muss.
Seit wann heissen Sie so?
Ich weiss es nicht. Schon als Kind habe ich ständig mit Vornamen experimentiert. Es gab eine Zeit, in der ich gerne ein Bub gewesen wäre. Da nannte ich mich Elisabeth John. In der Sek hiess ich dann für eine Weile Pierre. Meine Mitschülerinnen wollten mich Lisa nennen – wie die Kuh meines Grossvaters. Das kam natürlich überhaupt nicht in Frage.
Steht Pipilotti inzwischen auch in Ihrem Pass?
Ja. Für die Namensänderung musste ich mir von der schwedischen Botschaft bestätigen lassen, dass Pipilotti ein ehrbarer Vorname ist. Mir gefällt Pipi natürlich auch, weil es ein Synonym für Urin ist. Übertriebener Ernsthaftigkeit sollte man mit Selbstironie begegnen, finde ich.

Ein Name ist wie ein Kleid, das zu gross, aber auch zu klein sein kann. Passt Ihrer denn noch zu der 60-jährigen Frau, die Sie heute sind?
Manchmal verspricht er mehr, als ich halten kann. Vor allem Kinder sind oft enttäuscht, weil ich kein Pferd in die Luft stemmen kann und wohl nicht so frech bin wie Pippi Langstrumpf.
War in Ihrer Kindheit schon absehbar, dass einmal eine Künstlerin aus Ihnen wird?
Nein. Ich habe das bis in meine Zwanziger überhaupt nicht als Option betrachtet. Anfangs lebten wir in Sedrun, wo mein Vater Baustellen-Arzt war, für die Arbeiter, die die Staudämme in der Umgebung errichteten. Die meisten von ihnen waren Italiener. Sie vermissten ihre Kinder sehr und reichten uns als Ersatzkinder von Schoss zu Schoss.
Gab es in Ihrer Familie so etwas wie einen kreativen Humus, auf dem Ihre Talente gedeihen konnten?
Über meinen Vater existiert der Spruch, dass er mehr Zeit in der Dunkelkammer verbrachte als mit uns Kindern. Er entwickelte dort nicht nur seine Röntgenbilder, sondern auch viele eigene Fotos. Über die Jahre wurde er zu einem passionierten Fotografen. Herbert Mäder, ein enger Freund, der selbst ein bekannter Fotograf war, hatte ihn dazu inspiriert.

Und Ihre Mutter?
Sie war sehr belesen und vielseitig interessiert. Meine Mutter war Bauerntochter, mein Vater Bäckerssohn, beide gehörten zu jener ersten Generation nach dem Krieg, in der es möglich wurde, in eine höhere soziale Klasse aufzusteigen. Mein Vater konnte auf Pump studieren. Meine Mutter wurde gegen den ausdrücklichen Willen ihrer Eltern Lehrerin. Beide haben mir vorgelebt, welche Kraft darin liegt, den eigenen Horizont zu erweitern.
«Übertriebener Ernsthaftigkeit sollte man mit Selbstironie begegnen.»
Ab welchem Alter konnten Sie von Ihrer Kunst leben?
Erst mit 38. Das war eine unerwartete Freude. Nach meinem Kunststudium in Wien und Basel machte ich animierte Computergrafik für Ciba-Geigy und Roche. Auch bei der Migros habe ich im Video-Studio mitgearbeitet. Der Kunst widmete ich mich in dieser Zeit vor allem nachts. Es war der richtige Weg für mich, erst einmal einen anderen Beruf auszuüben, mit dem ich mein Geld verdiente. So konnte ich in meinem Kunstschaffen wirklich frei sein. Andernfalls hätte ich unter dem Druck gestanden, den Publikumsgeschmack bedienen und Dinge machen zu müssen, die sich in erster Linie gut verkaufen, um meine Existenz zu sichern. Das wollte ich nicht.
Erfüllt es Sie mit Genugtuung, dass Sie eine berühmte Künstlerin geworden sind?
Ich bilde mir überhaupt nichts darauf ein. Im Gegenteil, meine grösste Angst ist es, arrogant und abgehoben zu werden. Schön ist, wenn andere Menschen leuchtende Augen bekommen, wenn sie meine Kunst sehen.
Sie klopfen sich niemals selbst lobend auf die Schulter?
Nein, das ist mir unheimlich. Natürlich, ich habe viel gearbeitet. Aber es gab auch unzählige glückliche Umstände und Zufälle in meinem Leben, die mir zu Hilfe gekommen sind. Ich glaube übrigens auch nicht, dass Künstlerinnen und Künstler mehr Fantasie haben als andere Menschen oder ein reicheres Innenleben. Sie geniessen bloss das Privileg, sich von früh bis spät damit zu befassen.
Können Sie Ihrem Arbeitsjoch denn auch mal entkommen?
Ich kiffe gern, liebe die Natur und meditiere. Es geht mir dabei aber weniger darum, einem Joch zu entkommen als meinen Horizont zu erweitern.
Grosse Ausstellungen vorzubereiten erfordert einen immensen Kraftaufwand.
Das stimmt, aber mir steht ein ganzes Team aus fantastischen Mitarbeitern zur Seite, die mir bei der Logistik, beim Timing, den Budgets, der Technik und vielem mehr helfen. Unsere Hauptaufgabe besteht darin, herauszufinden, wie wir aus dem beschränkten Budget und der wenigen Zeit das Optimum herausholen können.
Wie sind Sie denn so als Chefin?
Mir ist eine gute Stimmung wichtig. Vielleicht bin ich manchmal etwas unklar, mäandere zu viel hin und her. Ich weiss es nicht … (ruft in die Runde) Leute, wie bin ich denn so als Chefin?
Mitarbeiter Dave Lang: Du bist die beste Chefin, die es gibt! Mitarbeiterin Nike Dreyer: Du bist eine energetische Supernova, so viel steht fest. Aber es kündigt ja niemand. Das spricht doch für sich.
Donnerwetter. Andererseits: Die beiden werden von Ihnen bezahlt. Die Chefin öffentlich zu kritisieren wäre kein schlauer Schachzug.
Manchmal sagen uns die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Museums, wir seien das professionellste Team, das jemals bei ihnen ausgestellt hat. Auf solche Komplimente bin ich stolz. Da kann ich mir dann auch mal auf die Schulter klopfen, uns allen.
Als Künstlerin müssen Sie Ihr Innerstes nach aussen kehren und es der Meinung der Öffentlichkeit aussetzen. Wie gut kommen Sie mit negativer Kritik zurecht?
Kürzlich habe ich eine Ausgabe der NZZ mitgestaltet. Da ging es gleich los in den Kommentarspalten: «Was ist denn das für ein Geschmiere!», «Man kann ja den Text kaum noch lesen!» Das hat mich eher amüsiert.
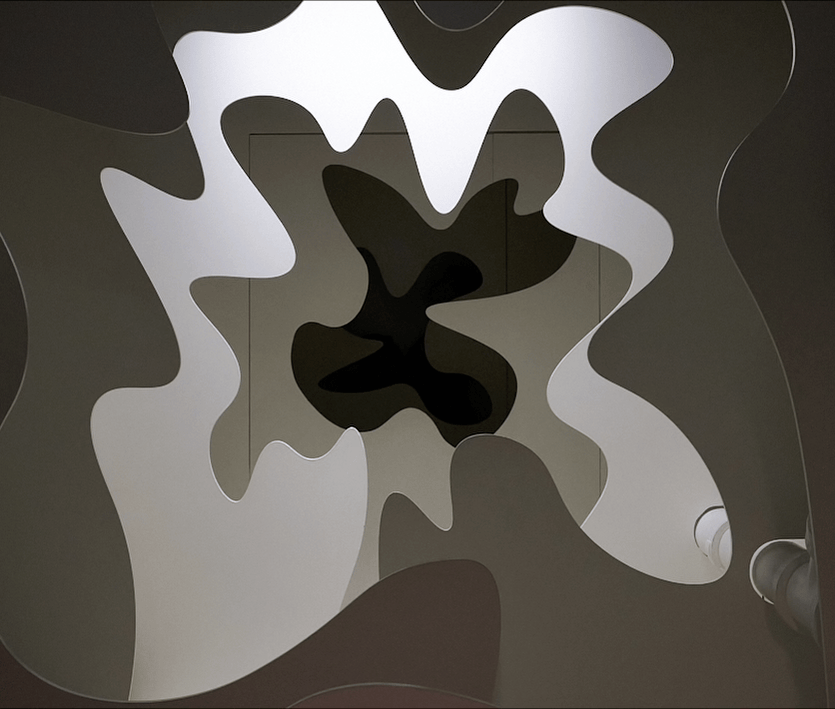
Und die Kritik in den Feuilletons, nehmen Sie die auch so locker? Ihnen wurde schon vorgeworfen, Ihre Kunst sei naiv, zu provokativ oder zu wenig politisch.
Meine Arbeit wurde oft verniedlicht, das hatte so etwas Despektierliches. Oder man stellte mich als eine Galionsfigur des Feminismus dar. Das nervt mich, denn ich bin zwar Feministin, aber ich möchte nicht darauf reduziert werden. Bei männlichen Künstlern redet man auch nicht die ganze Zeit über ihr Geschlecht. Als ich das erste Mal an der Biennale in Venedig teilnahm, liess ich in meinen Briefen nach Italien stets offen, ob ich ein Mann bin oder eine Frau – ganz bewusst, damit die mich nicht gleich in die Frauen-Schublade stecken. Als ich dann anreiste, riefen sie ganz erstaunt: È una donna!
Sie sind im Juni 60 geworden. Ist es für Sie ein Verlust oder eine Befreiung, nicht mehr jung und knackig zu sein?
Beides. Ich merke, dass sich meine Muskeln zurückbilden, das ist ein Verlust an Kraft. Aber dass mir die Männer nicht mehr hinterherpfeifen, empfinde ich als Befreiung.
Was möchten Sie mit dem Rest Ihres Lebens anfangen?
Ich muss endlich entrümpeln, damit das nicht eines Tages an meinem Bub hängen bleibt. Ansonsten mache ich einfach so weiter wie bisher.
«Ich bin zwar Feministin, aber ich möchte nicht darauf reduziert werden.»
Dass Sie Ihren Sohn Himalaya genannt haben, hat bei seiner Geburt vor zwanzig Jahren für einiges Stirnrunzeln gesorgt. Hatte das Zivilstandsamt eigentlich keine Einwände?
Nein, die haben das klaglos akzeptiert. Der zuständige Beamte war ein begeisterter Bergsteiger.
Und Himalaya? Hat er sich nie über seinen exotischen Vornamen beklagt?
Genau genommen hat er ja drei Vornamen: Himalaya, Yuji und Ansgar. Die meisten nennen ihn Yuji, was sowohl «grosszügig» als auch «die Ewigkeit verwalten» bedeutet. In Japan ist das ein geläufiger Name, von dem es 22 schriftliche Variationen gibt.

Wer Meisterschaft in einer Disziplin erlangen will, muss vieles andere diesem Ziel unterordnen. Was haben Sie für die Kunst geopfert?
Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich sicher öfter Verwandtschaft und Freunde besuchen. Zudem wäre ein zweiter Beruf ganz schön. Ich würde zum Beispiel gerne Polizistin sein.
Polizistin, ausgerechnet!
Polizistin zu sein ist doch ein wichtiger Dienst an der Gesellschaft. Wir Menschen haben einen gewissen Raubtier-Anteil in uns drin. Damit wir uns nicht gegenseitig zerfleischen, stellen wir diese ganzen Regeln und Gesetze auf, die die Polizei für uns durchsetzt. Ausserdem liebe ich Uniformen.
Sie meinen: Männer in Uniform?
Auch Frauen. Wie der Stoff den Körper so proper und schick umschmiegt – wunderbar.
Haben Sie heute eine andere Vorstellung davon, was ein gelungenes Leben ausmacht, als früher?
Na, Sie stellen vielleicht Fragen! Sie überschätzen mich wohl. Ich denke nicht oft über solche Dinge nach. Ja, was macht ein gelungenes Leben aus? Vielleicht: sich als Teil eines grossen Schwarms zu empfinden, mit anderen und für andere da zu sein. Das gilt aber damals wie heute.