
Meister Sebastian (Kapitel 7.2) Aus «Schneesturm im Sommer»
Am folgenden Tage machte er sich mit seinem zugedeckten Rückenkorb auf den Heimweg, betrat um Mitternacht ungesehen die Werkstatt und stellte die letzten zwei Gestalten ohne Licht zu den übrigen in die finstere Kammer. Als er am Morgen die Seinen begrüsste, jammerte die Frau, dass die Dorfkrämer und Bauern gedroht hätten, ihr nichts mehr zu geben, bevor die vielen alten Schulden bezahlt seien. Wie man dann leben sollte? «Habt noch ein wenig Geduld!», bat der Meister. «Der Fürst, der mir den grossen Auftrag gab, wird mir bald auch den Lohn aushändigen.» Er ging in die Werkstatt wie jeden Tag, aber statt zu schnitzen, zimmerte er aus festen Brettern sieben kleine Schränke und malte sie schwarz, sodass sie aussahen wie Kindersärge.
Eines späten Abends kam der Fürst von seinem Zug über das Gebirge zurück. Da er das bestellte Werk noch in der anbrechenden Nacht zu sehen wünschte, bat ihn der Meisterin der Werkstatt auf einen reich geschnitzten Lehnstuhl und zündete hinter ihm die Kerzen eines siebenarmigen Leuchters an. Das Licht fiel über den Sitzenden hinweg auf den mittleren Platz, um den im Halbkreis die schwarzen Schränke aufgestellt waren. Der Meister öffnete die ersten drei Schranktürchen, da traten der reiche Edelmann, der Bürger und der Bauer heraus und gingen auf dem Platz herum.
Der Fürst sprang vor Erstaunen auf, starrte die wandelnden Gestalten an und fragte heftig flüsternd: «Was sind das für Wesen?» Der Meister antwortete: «Es sind die ersten drei der sieben Figuren, die Ihr bei mir bestellt habt.» Die Verwunderung des Fürsten stieg noch, als Bürger und Bauer in menschlichen, wenn auch unverständlich gestammelten Lauten den herumstolzierenden Edelmann belästigten. «Ihr habt gewünscht», sagte der Meister, während er schon das vierte Schranktürchen öffnete, «dass ich sie recht lebendig mache, Herr, und das sind sie nun.» Der Fürst gab zu, diesen Wunsch geäussert zu haben, und wollte noch etwas beifügen, verstummte aber, da nun leise trällernd das schöne Mädchen herauskam und sich unter zierlichen Wendungen bewundern liess; er bemerkte, dass die drei Männer auf verschiedene, ihren Stand kennzeichnende Art um das Mädchen zu werben begannen, und in seinem immerfort staunenden Gesichte zeigten sich schon Anzeichen einer vergnügten Spannung.
Der Meister, der das Gesicht des Fürsten ängstlich forschend im Auge behielt, sah es mit Erleichterung und öffnete das fünfte Türchen. Beim Anblick des heraustorkelnden trunkenen Narren, der dem Werbespiel eine spasshafte Wendung gab, setzte sich der Fürst mit dem Ausdruck eines heiter Träumenden wieder in den Lehnstuhl. Schon beim nächsten Auftritt aber packte er wie erwachend die Lehnen des Stuhls und beugte sich vor. Der Teufel schlich heraus, vom Meister freigelassen, und umkreiste die fünf Gestalten, die ihn nicht zu gewahren schienen.
«Meister», rief der Fürst und schüttelte den Kopf, «sagt mir, was hier vorgeht!»
«Ich sehe nur, was sie treiben, und weiss nicht, wie es weitergehen würde, auch fehlt noch eine Figur», antwortete der Meister. «Im Sprechen und Handeln sind sie ungeübt, doch war das nicht meine Sache. Aber ich bitte Euch, Herr, mir doch zu sagen, ob die Figuren gelungen sind und Euch gefallen!»
«Die Figuren sind meisterhaft und der höchsten Bewunderung wert», gestand der Fürst, während ihn eine neue Wendung des Spieles fesselte. Der Meister nahm, glücklich aus voller Brust aufatmend, das fürstliche Lob entgegen, und zum ersten Mal entspannte sich sein hageres, bleiches Gesicht in Freude und Stolz über das gelungene Werk. Indessen war der Teufel unter die erschrockenen kleinen Leute getreten. Der Meister begegnete der drohenden Verwirrung, indem er die Kerzen bis auf eine löschte und das siebente Schranktürchen öffnete. Geisterhaft wandelte der Tod heraus, doch eh er die erschlaffenden Lebewesen anrühren konnte, löschte der Meister die letzte Kerze und trug die sieben erstarrten Gestalten rasch in ihre Gehäuse zurück.
«Sie leben nur im Lichte», erklärte er, nachdem er die Schränke geschlossen und die Kerzen wieder angezündet hatte.
«Es ist unheimlich und wunderbar», sagte der Fürst. «Wie habt Ihr das zustande gebracht?»
Der Meister antwortete: «Indem ich meine ganze Kunst und alle meine Kraft daran gesetzt, von meinem eigenen wie von fremdem Blut dazu gegeben und im Vertrauen auf den allerhöchsten Schöpfer weder den Teufel noch den Tod gefürchtet habe.»
Der Fürst erhob sich. «Dann ist es keine schlimme Zauberei, und das Werk soll mir willkommen sein», entschied er. «Die Schränke werden noch in dieser Nacht auf zwei Pferde geladen. Im Morgengrauen ziehen wir weiter. Hier ist ein Beutel mit fünfzig Goldstücken. Mehr kann ich zurzeit nicht entbehren, doch steht Euch der Weg zu mir immer offen, obwohl es ein weiter Weg ist, und wenn ich Euch helfen kann, soll es geschehen. Ich danke Euch, Meister Sebastian! Lebtwohl!»
Der Meister begleitete den Fürsten hinaus. Er half die sieben Schränke auf die Pferde zu laden und blieb die ganze Nacht wach. Als der Morgen graute, sah er zu, wie die Pferde ihre schwankenden Lasten mitten im Zug der fremden Kriegsleute bergab trugen, dann setzte er sich verlassen in die leere Werkstatt und wusste nicht mehr, was er mit seinen Augen sehen und mit seinen Händen tun sollte.
Bei Tagesanbruch kamen die Leute gelaufen, die etwas zu fordern hatten, der Bäcker, der Metzger, der Schneider, Krämer und Bauern. Sie zweifelten misstrauisch und finster an der Währschaftigkeit des Goldes, und der Meister Sebastian, der alle Schulden tilgen wollte, schloss den Beutel vorzeitig. Als sie mit dem Malefizgerichte drohten, erwiderte er zornig: «So bringt mich auf den Scheiterhaufen, ihr Narren, und seht dann, was ihr bekommt!» Am Ende aber nahmen sie das Gold und riefen, als sie es in der Hand hatten, für den Scheiterhaufen bleibe immer noch genug Verdächtiges übrig.
Die schlimmen Gerüchte umschlichen ihn auch weiterhin wie giftige Nebel und schlossen sich immer dichter um diesen und jenen Anlass zusammen, um das Gerippe vom Friedhof, den Schrecken der Frau vor den Werkstattgespenstern, die blutige Handauflegung des Töchterchens, um die Kapuzinerkutte, die der betrunken plaudernde Hansjoggel geschneidert haben wollte, und um die sieben schwarzen Kindersärge.
Todmüde, ohne Schaffenslust und gequält von den Klagen der Seinen, die ihren Ernährer im Verruf und das Gold im Schwinden sahen, ging er endlich fort. Er nahm nur sein Werkzeug, die Kutte und eine Wegzehrung mit, überliess das Gold seiner Frau und wanderte nachts durch den dunklen Wald bergab ins Unterland und weiter. Er lebte spärlich von den Gaben mildtätiger Leute, bekam an mancher Klosterpforte eine warme Suppe und schlief im Heu der Bauernhöfe.
Als der Winter anbrach, blieb er in einer grossen Stadt und erhielt von einem anderen Meister seines Handwerks eine Schnitzarbeit am Chorgestühl der neuen Kirche. Im Frühling wanderte er wieder und suchte nun das Schloss des Fürsten, doch erfuhr er schon auf dem Weg dahin, der Fürst sei zum Krieg in ein fernes Land aufgebrochen. Im Schlosse fand er nur eine geringe Besatzung und den Kastellan, der nichts von ihm und seinem Werke wusste.
Ratlos wanderte er weiter und kam zuletzt durch einen weiten, schönen Wald in die Nähe einer königlichen Residenz. Von der Dämmerung einer lauen Sommernacht überrascht, machte er sich im Walde ein Lager aus dürrem Laub. Als er sich aber zum Schlaf hinlegen wollte, hörte er die Klänge eines Horns und gewahrte in der Richtung, aus der sie kamen, hinter den Stämmen eine zarte goldene Helle. Verwundert ging er darauf zu und geriet abseits vom Weg vor ein weisses Gehege, dem zwei bewaffnete Wächter entlang schritten. Er blieb unbemerkt im Schatten eines Baumes, doch was er auf Rufweite im Lichte vieler Kerzen und Fackeln sah, erfüllte ihn mit Erstaunen und heftiger Neugier. Er schloff in seine braune Kapuzinerkutte, die ihn vor rohen Zugriffen schützen konnte, und wartete, bis wieder zwei Wächter vorbeigegangen waren, dann stieg er durch das lockere Gehege der weissen Birkenstämmchen und wagte sich im Schatten der Bäume so weit vor, dass ihm nichts mehr entging.
Zum Autor
Meinrad Inglin (1893–1971) Sohn eines Goldschmieds, Uhrmachers und Jägers, wurde mit siebzehn Jahren Vollwaise. Uhrmacher- und Kellnerausbildung, trotz fehlender Matura Studium der Literaturgeschichte und Psychologie in Bern, Genf und Neuenburg. Tätigkeit als Zeitungsredaktor, während des Ersten und Zweiten Weltkriegs Offizier im Grenzdienst. 1922 als Journalist in Berlin, danach als freier Schriftsteller in Schwyz. Für sein Werk (vor allem Romane und Erzählungen, einzelne Aufsätze, Notizen und eine Komödie) wurde Inglin vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Grossen Schillerpreis und dem Gottfried-Keller-Preis.
Eine bunte höfische Gesellschaft der vornehmsten Damen und Herren sass da im Halbkreis um einen sauber gelichteten Platz. Hinter ihr brannten auf der Terrasse eines grün umsponnenen, durch Bäume halb verdeckten Schlosses, das ein Sommersitz oder Jagdschloss des Königs sein musste, helle Fackeln, und vor dieser Terrasse herab erklang auch eine gedämpfte Musik. Auf dem freien Platz der Lichtung bewegten sich vor den Augen der vergnügten Zuschauer wie gelenkte Puppen auf der Bühne, nur anmutiger und natürlicher, kindergrosse Gestalten, die der Meister Sebastian innig erschrocken als seine Geschöpfe erkannte.
Er sah sie von der Seite, über den rechten Flügel der Zuschauer hinweg. Das schöne blonde Mädchen im veilchenblauen Gewande tanzte dort verführerisch und schien eine Buhlerin zu spielen, während der ausgelassen lachende gelbgrüne Narr in ihrem Dienste drei Männer heranlockte, die aber nicht wagten, sich ernstlich mit ihr einzulassen. Der Edelmann in seinem roten Ärmelrock, mit dem goldverzierten Gürtel und seinen halblangen Locken drehte ihr nach einem kurzen Getändel verzichtend den Rücken; der rotbraune Bürger näherte ihr mit Wohlgefallen sein selbstbewusstes kluges Gesicht, sprach ihr abe rtugendhafte Worte zu und wandte sich, als er ausgelacht wurde, beleidigt auch ab; der graubraune Bauer betrachtete sie begehrlich, kratzte sich in seinen ungekämmten Haaren und schlich weg. Ein koboldhaftes dunkles Wesen mit einer greulichen Fratze aber liess die drei Männer nicht aus dem Spiele treten, sondern trieb sie zurück in die Versuchung.
Meister Sebastian schaute alle entzückt an wie ein Vater seine unverhofft in voller Bewährung aufgefundenen Kinder. Sie sprachen hier viel klarer und traten sicherer auf als noch in seiner Werkstatt. Er war ganz versunken in den Anblick seines lebendigen Werkes, bis ein Gelächter der Zuschauer ihn weckte. Der Teufel machte dort hinten, als er die drei Männer wieder im Spiele sah, grinsend ein paar Sprünge und verschwand in einem Baumstrunk. Erst jetzt bemerkte der Meister, dass dort im laubigen jungen Randgehölz siebenmächtige alte Eichenstrünke halbkreisförmig die hintere Hälfte des Platzes umgaben.
Die sieben Strünke waren hoh lund trugen nur noch grünes Gestrüpp auf ihren morschen Schultern; jeder aber hatte gegen den Platz hin zwischen zwei brennenden Wachskerzen eine kleine Falltür. Fünf Türchen standen offen, eines war geschlossen, ein anderes fiel eben hinter dem eingefahrenen Teufel zu. Von jedem Falltürchen ging oben ein goldener Faden aus; die Fäden liefen in mässiger Höhe über sieben aufgehängte silberne Spulen, rückten über den Spielplatz hinab allmählich zusammen und vereinigte nsich mitten im Halbkreis der Zuschauer in der Hand eines erhöht sitzenden, reich gekleideten und kostbar geschmückten Herrn.
Meister Sebastian erriet, dass dieser Herr der König war. Sein rötliches Gesicht gefiel ihm nicht, es trug Züge liederlicher Ausschweifung und Herrschsucht. Auf ein beifälliges Klatschen seiner Gäste lachte er derb nach rechts und links, ergriff ein goldenes Trinkgefäss, das ein Page ihm kniend darreichte, trank gierig und hielt indes die Fäden wie die Leitseile eines Pferdegespannes in der linken Faust. Gleichzeitig spielten die Streicher und Bläser auf der Terrasse eine laute Tanzweise, die kleinen Männer auf dem Schauplatz wurden davon angesteckt und tanzten werbend um die schöne Buhlerin.
Der König aber zog bald an zwei Goldfäden, am ersten rasch, am zweiten zögernd. Der elfenbeinbleiche Tod im schwarzen Mantel trat aus seiner Eichenkammer, die Musik verstummte jäh, die Tänzer wichen erschrocken auseinander. Der Tod wandelte, vom Teufel gefolgt, auf den Bauern zu. Der Bauer fiel mit gefalteten Händen betend auf die Knie, und der geprellte Teufel lief davon wie ein geschlagener Hund. Der Betende erhob sich und folgte dem Tod gesenkten Hauptes ins Dunkel zurück. Die Tanzmusik erklang abermals, und der trunkene Narr versuchte die Lustbarkeit wieder anzufachen.
Meister Sebastian hing beglückt und selbstvergessen an seinen Geschöpfen. Die Wächter draussen aber führten jetzt, da es rings im Walde dunkel geworden war, grosse Wachhunde mit, die den fremden Kapuziner witterten und mit dröhnendem Gebell umstellten. Der König hörte, wütend über die Störung, ein Bettelmönch habe sich eingeschlichen, er befahl, ihn unverzüglich vorzuführen, und liess durch einen Spielwart die kleinen Leute in ihren Baumkammern verschwinden.
«Was habt Ihr hier zu suchen?», fragte er den Kapuzinerbarsch. Meister Sebastian bat um Verzeihung und erklärte, er sei zufällig in diesen Wald gekommen und, durch das Schauspiel hier verlockt, näher herangetreten, als ihm wohl erlaubt gewesen wäre, doch habe er einen guten Grund dafür. «Fasst Euch kurz!», fuhr ihn der König an. «Nun denn, o Herr, die sieben lebenden Spielfiguren da stammen ausmeiner Werkstatt und sind von meiner Hand», gestand der Meister. «Was faselt er da?», stiess der hohe Herr unwillig heraus, dann, nach einem rauen Auflachen, rief er: «Spielwart, he, hieher! Ihr habt mich schon nach dem Wundermann gefragt, der unsere Kleinen erschaffen hat. Da steht er, seht ihn an!» Er lachte noch einmal auf und schüttelte den Kopf.
Der Meister sagte, er sei Holzschnitzer von Beruf, und nannte den Fürsten, der ihm den Auftrag gegeben hatte. Da zog der König drohend die Brauen zusammen und fragte: «So? Und darum seid Ihr zufällig hieher gekommen? Der Zufall sieht recht planmässig aus, Pater Schlaumeier. Die sieben Figuren sind ein Geschenk des Fürsten an seinen König, das weiss in meinem Lande jedermann, und so war es leicht zu erfahren.» Der Meister erwiderte: «Ich habe die Wahrheit gesagt, die sieben Figuren sind von mir …» Der gereizte Königunterbrach ihn jähzornig: «Und wenn sie von Euch wären, der Fürst würde sie Euch nicht gestohlen, sondern abgekauft haben.»
«Wenn Ihr so denkt, Herr, habe ich hier nichts mehr zu suchen», entgegnete der Meister, neigte gemessen den Kopf und wandte sich ab. «Unverschämter Frechdachs!», rief ihm der König nach.
Der Spielwart, ein schlanker, bleicher Mann, schien für den beschleunigten Abgang des Kapuziners sorgen zu wollen, er folgte ihm hinter das Schloss und zeigte ihm den Rückweg. «Pater», sagte er gedämpft, «was Ihr gesehen habt, ist nur ein königlicher Zeitvertreib. Vor kunstverständigen fremden Gästen gibt der König die Fäden in meine Hand, dann wird das Geheimnis der spielenden Lebewesen noch bezaubernder, die Spiele werden reicher, feiner geknüpft und haben einen tieferen Sinn. Dies sei Euch im Vertrauen gesagt. Furchtbar ist mir der Gedanke, Ihr könntet die Wahrheit gesprochen und Verkennung geerntet haben. Es geziemt sich für mich aber nicht, anderer Meinung zu sein als mein Herr. Und selbst wenn ich die Glaubwürdigkeit Euerer Aussage auch künftig noch erwägen wollte, so könnte ich gegen den einmal festgelegten allerhöchsten Eigenwillen nichts mehr ausrichten. Gepriesen sei der unvergleichliche Meister, der das Wunderwerk der sieben lebendigen Figuren geschaffen hat!» Er verbeugte sich tief und kehrte vor das Schloss zurück.
Der Meister blickte ihm bitter nach und schlug den Rückweg ein. Ziellos wanderte er nun herum, Müdigkeit und Hunger zehrten an seinen Kräften, die Fremde wehte ihn an wie ein Winterwind, und die Erniedrigungen des Bettlerlebens wurden ihm unerträglich. Er fühlte sich reif zum Sterben und beschloss, heimzukehren, um noch dies und jenes in Ordnung zu bringen. Daheim wollte er auf sich nehmen, was ihm beschieden sein würde, und ruhig dem Ende entgegensehen.
Der Heimweg war aber weit, und als er endlich durch das ihm vertraute Unterland kam, sah er in der Ferne die Wälde rund Berge schon winterlich verschneit. Mit dem schwachen Rest seiner Kraft und seines Willens wanderte er das Hügelland hinan, doch im Tannenwald vor seinem Dorf erschöpfte ihn das Waten durch den wachsenden Schnee, er brach auf die Knie und konnte sich nicht mehr selber erheben.
Es war mitten in der Nacht, er durfte nicht hoffen, dass hier jemand kommen würde. Zitternd kniete er im tiefen Schnee und wandte das Angesicht dorthin, wo über dem Walde der Heimatort seines Lebens, Kämpfens und Leidens lag. Da sah er zwischen den Stämmen einen bläulichen Schein wie vom bald aufgehenden Mond, der Schein kam näher und wurde so hell und warm, dass ihm ein Gestirn gleich folgen musste. Ein Gestirn war es nicht, doch wandelten im milden Goldglanz zwei Gestalten heran, und der Meister erkannte sie. Die eine Gestalt war die seines ersten grossen Werkes, der gekreuzigte Heiland, die andere war sein gemarterter heiliger Sebastian. Mit erschrockener Seele streckte er hilfesuchend die Arme nach ihnen aus. Sie waren in der Kirche vom Marterholz herabgestiegen und kamen dem Meister entgegen, sie halfen ihm aus dem Schnee, nahmen ihn in ihre Mitte und führten ihn bergauf in die ewige Seligkeit.
- Die «Editorische Notiz» zum Buch finden Sie hier.
- Jeweils sonntags wird der Roman «Schneesturm im Hochsommer» auf zeitlupe.ch fortgesetzt.
- Weitere Kapitel können Sie hier lesen.
«Schneesturm im Sommer»
Meinrad Inglin ist einer der bekanntesten Unbekannten, seinen Namen kennen fast alle, seine Werke die wenigsten. Dabei ist er ein grosser Könner in einem grossen Spektrum unterschiedlicher literarischer Genres, stilistisch abwechslungsreich und sprachlich wohlkomponiert. «Schneesturm im Hochsommer» versucht, sein vielfältiges Schaffen abzubilden und damit einen literarisch hochinteressanten und oft überraschend aktuellen Schweizer Klassiker wieder breiter bekanntzumachen.
«Inglin ist seit Jahren genau der, von dem viele sagen, man hätte ihn ‹nicht auf dem Schirm› und der deshalb allen so präsent ist. Die Frage ist doch vielmehr: Was macht den Kerl so interessant, dass er nicht verschwindet? Er hat nie auf Effekt geschrieben. Er hat versucht, Verhältnisse zu beschreiben, wie sie sind. Eine Haltung, die nach dem ganzen postmodernen Klimbim auf eine neue Art interessant ist.»
Peter von Matt
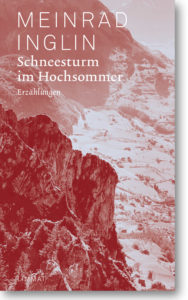
Meinrad Inglin, «Schneesturm im Hochsommer».
Herausgegeben von Ulrich Niederer, Nachwort von Usama Al Shahmani, 256 Seiten, Leinenband, CHF 28.– (UVP), Limmat Verlag, Zürich
Umschlagfotografie: Dino Reichmuth, Unsplash
Typografie und Umschlaggestaltung: Trix Krebs
Druck und Bindung: Friedrich Pustet, Regensburg
ISBN 978‑3‑03926‑021-8
© 2021 by Limmat Verlag, Zürich www.limmatverlag.ch
