
Meister Sebastian (Kapitel 7.1) Aus «Schneesturm im Sommer»
Vor langer Zeit wandte sich ein Holzschnitzer in seiner Werkstatt stöhnend vom unfertigen Bilde des Gekreuzigten ab, das ihm nicht gelingen wollte. Er sah ein anderes, kleineres Kruzifix an, das er früher geschnitzt hatte, und es gefiel ihm nicht mehr. Er betrachtete drei angefangene Wappentiere, Steinbock, Bär und Leu, die er für einen Ratsherrn schnitzen sollte, und spürte keine Lust dazu. Als sein Blick aber durch ein offenes Fenster auf die nahe Dorfkirche fiel, für die das grosse Kruzifix bestimmt war, und auf die bunt gekleideten fremden Ritter und Söldner, die dort gebetet hatten und nun weiter über das Gebirge zogen, da kehrte er vor das unfertige Werk zurück und sagte in einem harten, beschwörenden Tone: «Es muss gelingen, mag es mich Zeit und Kräfte kosten, so viel es will!» Während er das sagte, erfüllte ein Glühen, Sausen und Knistern die Werkstatt, als ob darin Feuer ausgebrochen wäre, und eine Stimme rief: «Ans Werk! Es muss und wird gelingen!» Der Bildschnitzer glühte nun so vor Schaffenslust, dass er nicht wusste, hatte er seine eigene oder eine fremde Stimme gehört. Er ging ans Werk und arbeitete rastlos Tag für Tag von früh bis spät. Das Bild des Gekreuzigten wurde ein Meisterwerk, und alle Gläubigen, die es in der Kirche sahen, waren davon ergriffen.
Der Meister aber fühlte sich nach seiner Arbeit so müde wie noch nie. Er schnitzte wohl dies und jenes und machte auch die Wappentiere fertig, doch diese Dinge genügten ihm nicht mehr, und er achtete sie gering. Da hörte er in mancher Nacht noch wie im Traum die Stimme wieder, und sie sagte: «Drüben in der Kirche steht auf einem Seitenaltar das Pfuschwerk eines heiligen Sebastian; verdient dein Namenspatron kein besseres Bild?» Er fragte die Kirchgemeinde an, ob man ihm einen solchen Auftrag erteilen wolle, aber man liess ihn warten; er suchte einen Stifter und fand keinen. «So muss ich es bleiben lassen», dachte er. «Ich habe eine Familie zu ernähren und kann nicht nur um Gotteslohn arbeiten.»
Die Stimme kümmerte sich nicht darum und mahnte immer dringender. Er sah den Märtyrer Sebastian mit Stricken rücklings an den Baumstamm gebunden, den Leib von Pfeilen getroffen, das schmerzlich verklärte Angesicht zum Himmel gewandt. Es glühte und knisterte wieder durch die Werkstattwie von einem Brande, und plötzlich lief ein kleiner, feueriger Mann auf den Meister zu und rief ungeduldig: «Ans Werk! Ans Werk!» Der Meister wich erschrocken zurück und fragte: «Wer bist du, dass du mich zu einem Werk verführen darfst, das niemand von mir verlangt?» Der Feuerige erwiderte: «Frag nicht, schaffe!» Der Meister rief dagegen: «Ein Verführer bist du, dein Atem glüht ja, ein Teufel bist du mit deiner Zwängerei!»
Der Unheimliche drang wie eine Flamme fauchend mit den Worten auf ihn ein: «Ans Werk, du Tor! Kein Teufel könnte auch nur wünschen, was ich will. Ans Werk, Meister Sebastian! Der Gekreuzigte ist dir gelungen, der Märtyrer wird dir auch gelingen.» Der Meister glühte vor Schaffenslust, er ging an die Arbeit und liess alles andere liegen, bis der Märtyrer Sebastian vollendet war. Die Gemeinde sah auch dieses Werk gern in der Kirche und gewährte freiwillig ein Entgelt dafür, doch ein karges. Der Meister war erschöpft und musste bald mit seiner Familie darben. Die geringen Aufträge, die er noch ausführte, trugen ihm nur wenig ein und machten ihm keine Freude.
Da staunte eines Tages ein fremder Fürst und Kriegsherr, der mit vielem Gefolge über das Gebirge zog, in der Kirche die beiden Werke an und liess sich darauf zum Holzschnitzer führen. «Ihr seid ein vortrefflicher Meister!», sagte er zu ihm. «Schnitzt mir sieben Figuren, und ich will Euch dafür gut belohnen.» Meister Sebastian war mit Freuden bereit und fragte, was für Figuren es sein müssten. Der Fürst antwortete: «Ein reicher Edelmann, ein Bürger, ein Bauer, ein trunkener Narr, ein schönes Mädchen, der Teufel und der Tod. Sie sollen so gross sein, dass sie Euch bis zum Gürtel reichen. Bemalt sie auch und macht sie recht lebendig!»
Der Meister rüstete sieben gleiche Blöcke vom besten Lindenholz und ging an die Arbeit. Er schnitzte zuerst die Figur des Edelmanns und spürte schon bald, dass ihn einer anfeuerte. Diesmal war ihm der glühende kleine Mann willkommen, und er gehorchte seiner Stimme, ohne zu fragen oder nach ihm hinzusehen. Als er prüfend den fertigen Edelmann betrachtete und nicht recht zufrieden war, sagte die Stimme: «Ein wenig fehlt ihm noch, aber das kannst du nachholen, jetzt kommt der Bürger dran.» Er schnitzte und bemalte die Figur eines städtischen Bürgers, die ihm besser gelang, aber auch nicht ganz vollkommen. «Du kannst nachholen, was ihr fehlt, jetzt kommt der Bauer dran», sagte die Stimme. Mit dem Bauern ging es ihm ähnlich, es fehlte dieser trefflichen Figur zuletzt auch nur noch ganz wenig.
Er begann darauf am trunkenen Narren zu schnitzen, sah ihn aber nicht deutlich genug vor sich. «Der Schneider Hansjoggel im Unterdorf wär wohl ein rechter Schalksnarr, abe rbetrunken hab ich ihn noch nie gesehen», dachte er. «So mach ihn betrunken!», sagte die Stimme. Da bat er am selben Abend den lustigen Schneidergesellen zu einem Trunk ins Wirtshaus und zechte mit ihm bis Mitternacht; das tat er auch an den folgenden Abenden und sah seinen Narren immer deutlicher. Im Dorfe aber schüttelten die Leute den Kopf und sagten: «Der Meister Sebastian gerät auf Abwege, er lockt den Schneider Hansjoggel ins Wirtshaus und versauft sein Geld mit ihm.» Indessen gelang ihm der trunkene Narr so gut, dass er beinahe zufrieden war, wenn auch nicht ganz. Voller Schaffenslust begann er nun das schöne Mädchen aus dem Holz zu schnitzen, er gab ihm die Gestalt und Farbe seiner eigenen, lieblich blühenden Tochter und meinte zuletzt, es sei wohlgelungen.
Der Teufel und der Tod machten ihm die schwerste Mühe, er hatte sie nicht richtig vor Augen, und sie wollten ihm keine Gestalt annehmen. Er ging auf den Friedhof zum Totengräber, der ein Grab aufmachte, gab ihm Geld und gute Worte und bekam dafür den Schädel und die Gebeine aus dem Grab. In seiner Werkstatt setzte er das Gerippe zusammen, stellte es auf und schaute es häufig an. Er blieb mit seiner Arbeit am Tod aber trotzdem stecken und beschloss, zuerst nachzuholen, was er nicht ganz fertig gemacht hatte. Er stellte drei Figuren vor sich hin, Edelmann, Bürger und Bauer, ersah, dass ihnen etwas fehlte, und wusste nicht, was, doch brannte er vor Ungeduld, und als es Abend wurde, rief er glühend: «Ihr sollt mir leben, und wenn ich euch von meinem eigenen Blute geben muss!»
Die Stimme des Feuerigen dröhnte und zischte ihm in die Ohren: «So gib her! Es fehlt ihnen nur ein Fünklein Leben. Gib her von deinem Blut!» Der Meister schnitt sich fieberhaft in die linke Hand, sie blutete, und er legte sie dem Edelmann, dem Bürger und dem Bauern auf das Gesicht. Da erwarmten die Figuren, bewegten sich und begannen wie träumend auf der Werkbank herumzugehen. Der Meister wich erschrocken zurück und starrte seine erwachten Geschöpfe an, aber er sah sie in der rasch zunehmenden Dämmerung immer undeutlicher und meinte am Ende, sich getäuscht zu haben. Als er in der Dunkelheit nähertrat, standen die drei Gestalten wieder ruhig da, er betastete sie, und sie regten sich nicht mehr. Das Blut aber floss ihm noch immer aus der Hand, er verband sich die Wunde und sank vor Schwäche in einem Winkel zusammen.
Zum Autor
Meinrad Inglin (1893–1971) Sohn eines Goldschmieds, Uhrmachers und Jägers, wurde mit siebzehn Jahren Vollwaise. Uhrmacher- und Kellnerausbildung, trotz fehlender Matura Studium der Literaturgeschichte und Psychologie in Bern, Genf und Neuenburg. Tätigkeit als Zeitungsredaktor, während des Ersten und Zweiten Weltkriegs Offizier im Grenzdienst. 1922 als Journalist in Berlin, danach als freier Schriftsteller in Schwyz. Für sein Werk (vor allem Romane und Erzählungen, einzelne Aufsätze, Notizen und eine Komödie) wurde Inglin vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Grossen Schillerpreis und dem Gottfried-Keller-Preis.
Die Frau des Meisters trat mit einem Licht in die Werkstatt, um nach ihrem Mann zu sehen. Die drei Gestalten erwachten aber, als das Licht auf sie fiel, und begannen herumzugehen. Die Frau schrie auf vor Schreck. Der Meister hob den Kopf, er war sterbensmüde und halb von Sinnen, er sah hinter den bunten Gestalten wie in einem schwarzen Mantel das drohende Gerippe, er sah den Tod. Als seine Frau schreiend mit dem Lichte hinauslief, wurde es dunkel und still, erliess den Kopf sinken und schlief ein.
«Auf, ans Werk, du hast den Tod gesehen!», rief der glühende Zwinger im frühen Morgenlicht, und schon wandelten der Edelmann, der Bürger und der Bauer auf der Werkbank herum. Er stand auf, schloss die drei Gestalten schaudernd in eine finstere Kammer und fing an, am Tod zu schnitzen. Als er damit fertig war, sah er so bleich und abgezehrt aus, dass ihn die Leute fast nicht mehr erkannten.
Unterdessen hatte seine Frau ihren Schrecken nicht für sich behalten können, und es lief ein schlimmes Gerede über den Meister im Dorf herum. Ihm selber schien auch, es gehe nicht mehr mit rechten Dingen zu, er verzweifelte fast an seiner Kunst und rührte eine Weile kein Werkzeug mehr an. Nachdem er sich ein wenig erholt hatte, spürte er aber einen heissen Atem im Gesicht und dachte: «Ich muss nur noch den Teufel schnitzen, das will ich doch versuchen.» Er versuchte es, aber auch der Teufel wollte ihm lange keine Gestalt annehmen.
«So will ich zuerst den Narren und das Mädchen fertigmachen», beschloss er, betrachtete diese beiden Figuren und fand, dass ihnen nur ein Fünklein Leben fehle. Er schnitt sich noch einmal und legte auch ihnen seine blutende Hand auf das Gesicht. Das erweckte sie aber nicht, sie blieben kühl und unbewegt. «Der Hansjoggel und meine Tochter hätten vielleicht das rechte Blut dafür», fiel ihm ein, doch scheute er davor zurück. «Ans Werk, ans Werk!», dröhnte und zischte es ihm in die Ohren.
Er ging mit dem Schneidergesellen abends wieder ins Wirtshaus und lockte ihn nach Mitternacht in seine Werkstatt. Hier zapfte er dem Betrunkenen wie aus Versehen ein wenig Blut ab und strich es seiner Narrenfigur ins Gesicht. Die Figur erwarmte und begann zu schwanken. Er sperrte sie zu den anderen in die dunkle Kammer, verband den Hansjoggel und führte ihn nach Hause. In der Dämmerung des folgenden Abends rief er seine junge Tochter zu sich, doch widerstrebte es ihm, ihr abzulisten, was er brauchte, und er zog sie ins Vertrauen. Sie liess sich die Hand ritzen und legte sie blutend auf das hölzerne Mädchengesicht, aber ihr war unheimlich zumute, und eh sie noch recht merkte, dass das Mädchen erwachte, lief sie davon. Sie kam mit der blutenden Hand zur Mutter und bekannte auf ihr Zureden hin, was sie hatte tun müssen.
Der Meister verbrachte eine qualvolle Nacht in seiner Werkstatt. Was er getrieben hatte, erschien ihm nicht mehr als ehrliche Kunst, sondern als Teufelswerk, er wollte alles bereuen, allem entsagen und Busse tun. Der Feuerbutz aber drang auf ihn ein, und seine Worte dröhnten wie Hammerschläge: «Mach fertig, was du angefangen hast!» Der Meister gelobte es entschlossen und sah darauf, schon halb im Schlaf und wie von Fieberträumen heimgesucht, den Teufel, der dem Werk noch fehlte. Bei Tagesanbruch ging er begierig an die Arbeit und schnitzte mit seiner letzten Kraft auch diese Figur.
Unterdessen hatte seine Frau in ihrer Angst und Sorge abermals nicht für sich behalten können, was sie wusste. Die Dorfleute bekreuzten sich, wenn sie an der Werkstatt vorbeigingen. Die Gemeinde drohte, den Meister wegen Zaubereivor Gericht zu stellen. Eines Abends rief ihm ein betrunkener Bauer aus dem offenen Wirtshausfenster zu: «Wohin, Hexenmeister? Gehst die schwarze Emerenz besuchen?» Dies alles brachte den Meister fast dem Wahnsinn nahe, doch die höhnische Frage des Betrunkenen gab ihm auch einen Plan zur Vollendung des Werkes ein. Während er diesen Plan erwog und schon wieder verwerfen wollte, weil er ihn frevelhaft fand, brauste ein Feuersturm durch die Werkstatt. Der Zwinger stampfte vor ihm auf den Boden, er sprühte wie rotglühendes Eisen, das gehämmert wird, seine Blicke blitzten und seine Worte forderten unerbittlich die Vollendung. «So will ich es tun», sagte der Meister. «Und möge mir Gott verzeihen, wenn ich unrecht tue!»
Er nähte den Teufel und den Tod in Säcke, liess sich durch den Schneidergesellen heimlich eine braune Kapuzinerkutte machen und steckte die Kutte samt den beiden noch unerweckten Figuren in einen geräumigen Rückenkorb. Den Seinen sagte er, man erwarte ihn im Unterland zu einer Arbeit, und schon in der Nacht darauf wanderte er mit dem Rückenkorb durch den Tannenwald bergab, nachdem er die dunkle Kammer verschlossen und den Schlüssel zu sich genommen hatte. Im Unterland pochte er, als Kapuziner verkleidet, an die Pforte eines Frauenklosters und gab an, die Besessenheit der Schwester Emerentia durch den Bösen sei überall ruchbar geworden; er habe den Auftrag, etwas gegen dies grosse Ärgernis zu tun, man möge ihm hier in der Nähe eine Unterkunft besorgen und ihn rufen, wenn das Übel sich zeige.
Er bekam eine Kammer im nahen Bauernhof, der dem Klostergehörte, und hier fügte sich alles günstig. Der alte Bauer war todkrank, er ging einem raschen Ende entgegen, und die vielbeschäftigten jungen Leute nahmen den unverhofften Beistand eines Kapuziners gern an. Der Meister wachte nachts beim Sterbenden, ritzte ihm die Hand und legte sie blutend auf das geschnitzte Angesicht des Todes, da begann sich die Figur im Licht der Sterbekerze zu regen. Am Morgen sagte er den jungen Leuten, er habe dem Sterbenden durch einen geringen Aderlass ein wenig Linderung verschafft. Einige Tagespäter wurde er ins Kloster zur schwarzen Emerenz gerufen.
Der junge Bauer hatte ihm erzählt, diese vielgeplagte Schwester, die im Absonderungshaus lebe, berichte nach ihren Anfällen selber, der Teufel habe sie besessen, und es sei schon zwei Beichtvätern mit allen geistlichen Mitteln nicht gelungen, ihn auszutreiben. Als der Meister mit seiner verhüllten Figur die Zelle betrat und hinter sich die Tür versperrte, wälzte sich die arme Nonne bewusstlos am Boden und hatte Schaum vor dem Munde. Er enthüllte den Kopf seiner Figur, packte und ritzte die Linke der Besessenen und zwang sie blutig auf die geschnitzte Teufelsfratze. Ihm graute vor dem, was nun geschah, er schloss den zuckenden Sack rasch zu, verband die blutende Hand und löschte die Kerze, dann hob er die Nonne auf ihr Lager und blieb bei ihr, bis sie ruhig wurde und erschöpft einschlief.
- Die «Editorische Notiz» zum Buch finden Sie hier.
- Jeweils sonntags wird der Roman «Schneesturm im Hochsommer» auf zeitlupe.ch fortgesetzt.
- Weitere Kapitel können Sie hier lesen.
«Schneesturm im Sommer»
Meinrad Inglin ist einer der bekanntesten Unbekannten, seinen Namen kennen fast alle, seine Werke die wenigsten. Dabei ist er ein grosser Könner in einem grossen Spektrum unterschiedlicher literarischer Genres, stilistisch abwechslungsreich und sprachlich wohlkomponiert. «Schneesturm im Hochsommer» versucht, sein vielfältiges Schaffen abzubilden und damit einen literarisch hochinteressanten und oft überraschend aktuellen Schweizer Klassiker wieder breiter bekanntzumachen.
«Inglin ist seit Jahren genau der, von dem viele sagen, man hätte ihn ‹nicht auf dem Schirm› und der deshalb allen so präsent ist. Die Frage ist doch vielmehr: Was macht den Kerl so interessant, dass er nicht verschwindet? Er hat nie auf Effekt geschrieben. Er hat versucht, Verhältnisse zu beschreiben, wie sie sind. Eine Haltung, die nach dem ganzen postmodernen Klimbim auf eine neue Art interessant ist.»
Peter von Matt
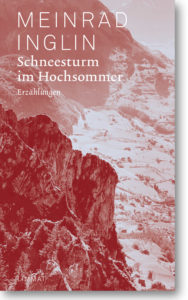
Meinrad Inglin, «Schneesturm im Hochsommer».
Herausgegeben von Ulrich Niederer, Nachwort von Usama Al Shahmani, 256 Seiten, Leinenband, CHF 28.– (UVP), Limmat Verlag, Zürich
Umschlagfotografie: Dino Reichmuth, Unsplash
Typografie und Umschlaggestaltung: Trix Krebs
Druck und Bindung: Friedrich Pustet, Regensburg
ISBN 978‑3‑03926‑021-8
© 2021 by Limmat Verlag, Zürich www.limmatverlag.ch
