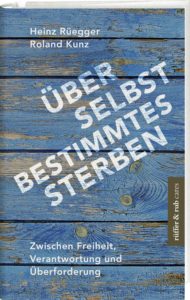Zwischen Freiheit und Überforderung
Die medizinischen Möglichkeiten zu immer noch weiteren Behandlungen zwingen zu Entscheidungen. Das neue Buch von Heinz Rüegger und Roland Kunz macht Mut, sich mit den Fragen rund um das eigene Sterben und den Tod auseinanderzusetzen.
Text: Usch Vollenwyder
Über Jahrhunderte war der Tod eine allgegenwärtige Schicksalsmacht. Ob er auf leisen Sohlen daherkam oder mit plötzlicher Gewalt hereinbrach – er wurde als gottgegeben akzeptiert und die Menschen hatten sich ihm zu fügen. Erst mit dem medizinischen Fortschritt konnte das Ende des Lebens auf- und vielfach weit hinausgeschoben werden. «An den Rand eines langen Lebens», schreiben der Theologe und Ethiker Heinz Rüegger und der Geriater und Palliativmediziner Roland Kunz in ihrem gemeinsamen Buch «Über selbstbestimmtes Sterben». Sie gehen darin Fragen rund um Sterben und Tod nach, die ein modernes Gesundheitssystem und eine hoch entwickelte Medizin stellen.
Das Thema interessiert Sie?
Werden Sie Abonnent/in der Zeitlupe.
Neben den Print-Ausgaben der Zeitlupe erhalten Sie Zugang zu sämtlichen Online-Inhalten von zeitlupe.ch, können sich alle Magazin-Artikel mit Hördateien vorlesen lassen und erhalten Zugang zur Online-Community «Treffpunkt».