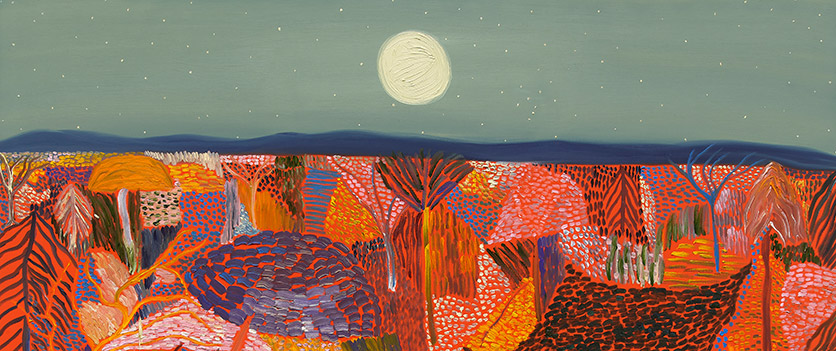Meisterdiebe und Gentleman-Gangster
In ihrem «Atlas der Kunstverbrechen» versammelt die amerikanische Autorin Laura Evans die spektakulärsten Fälle von Kunstraub, Fälschungen und Vandalismus.
Text: Claudia Senn
Kunstdiebe geniessen ein gewisses Prestige. Schliesslich kommen bei ihren Delikten normalerweise keine Menschen zu Schaden. Zudem erntet die Raffinesse, mit der sie die manchmal allzu laschen Sicherheitsmassnahmen der Museen aushebeln, Bewunderung. Wer ein berühmtes Gemälde stiehlt, kann sich der Aufmerksamkeit der Medien deshalb gewiss sein und wird vielleicht sogar in einem Kino-Film oder einer Netflix-Serie verewigt. Es ist unsere eigene Sehnsucht nach dem Regelbruch, die uns diese Faszination empfinden lässt. Dabei sind die Opfer der vermeintlichen Gentlemen-Gangster wir selbst, die Museumsbesucherinnen und -besucher, die statt des kostbaren Bildes nur noch eine Leerstelle vorfinden.
Laura Evans, Professorin für Kunst- und Museumspädagogik an der University of North Texas in Denton und Expertin für Kunstkriminalität, nimmt sich in ihrem «Atlas der Kunstverbrechen» der Schattenseiten der Branche an. Das sind, soviel wird bald klar, ganz schön viele. Ihr ebenso lehrreich wie unterhaltsam geschriebenes Buch gibt Einblick in die True-Crime-Fälle und Cold Cases des Kunstbetriebs. Neben Diebstählen widmet sie sich auch Fälschungen und Kunst-Vandalismus.
Schon der legale Kunstmarkt ist alles andere als koscher. Über 60 Milliarden Franken werden hier jährlich umgesetzt, nicht nur von Galeristinnen und Kunstsammlern, sondern auch von zwielichtigen Gestalten, denen das Monetäre mehr am Herzen liegt als ein gelungener Pinselstrich. Teure Kunst eignet sich trefflich dafür, Gelder zu waschen oder sie dem Fiskus zu hinterziehen. Manche Preziose wird nur zu diesem Zweck angeschafft und fristet jahrzehntelang ein unspektakuläres Dasein im Depot eines Zollfreilagers, ohne dass ihr Betrachter sich jemals an ihr erfreuen würde. Zudem präsentieren nicht wenige Museen Werke, die sie sich in Zeiten von Krieg und Kolonialisierung auf unfeine Art und Weise angeeignet haben.
Illegal gehandelte Kunst gilt heute nach Drogen und Waffen als drittgrösster Schwarzmarkt der Welt, so Laura Evans. Das «Art Theft Team», eine 1992 gegründete Spezialeinheit des amerikanischen FBI, schätzte zu Anfang des Jahrtausends, dass jährlich Kunstwerke im Wert von vier bis sechs Milliarden Dollar entwendet werden. Heute, gut zwanzig Jahre später, dürfte der Schwund nicht geringer ausfallen.
Einer der fleissigsten Kunsträuber war wohl der Franzose Stéphane Breitwieser. Der unscheinbar wirkende Kellner, der noch bei seiner Mutter wohnte, stahl zwischen 1995 und 2001 fast 240 Objekte aus rund 180 Museen auf der ganzen Welt. Im Durchschnitt also alle neun Tage ein Werk. Stets stand seine Freundin Anne-Catherine Kleinklauss Schmiere. Der umtriebige Meisterdieb verhökerte seine Beute nicht etwa auf dem Schwarzmarkt, sondern bunkerte alles in seinem stets gut verschlossenen Schlafzimmer. «Die Freude am Haben ist stärker als die Angst beim Stehlen», gestand er später in einem Interview. Erwischt wurde er schliesslich 2001 in Luzern, wo er im Richard-Wagner-Museum ein Jagdhorn aus dem 16. Jahrhundert mitgehen liess. Bevor das Haus seiner Mutter durchsucht werden konnte, hatte diese unzählige Gemälde in einem Müllschlucker entsorgt oder verbrannt und Kunstgegenstände in einen Kanal geworfen. Als ihr Sohn erfuhr, welch schreckliches Schicksal seine Schätze erlitten hatten, unternahm er in seiner Zelle vor Kummer einen Selbstmordversuch.
Lösegeld statt Prämienzahlungen
Je berühmter und wertvoller ein gestohlenes Kunstwerk ist, desto unmöglicher ist es, das Oeuvre gewinnbringend weiterzuverscherbeln. Kein Hehler will sich an der heissen Ware die Finger verbrennen. Auch Mafiabosse, die einen Raub in Auftrag geben, um sich klammheimlich einen Picasso über den Kamin hängen zu können, entspringen wohl eher der Fantasie als der Realität. Viel wahrscheinlicher ist es, dass die Kunstdiebe ihre kostbare Beute der Versicherung des Besitzers gegen Lösegeld zurückverkaufen. Das kommt das Unternehmen meist immer noch günstiger zu stehen als die Prämie, die im Schadensfall fällig wäre. Aus naheliegenden Gründen werden solche Deals nicht an die grosse Glocke gehängt.

Ganz anders lief es im Fall eines Kunstwerks von Maurizio Cattelan. Der in New York lebende Italiener, eine Art Klassenclown der Kunstszene, baute eine Toilette aus purem Gold und nannte sie «America». Erstmals stellte Cattelan seine Luxus-Latrine 2016 im Guggenheim-Museum aus, wo 100’000 Besucherinnen und Besucher einen 3-Minuten-Slot buchen konnten, um das güldene Objekt für den ihm zugedachten Zweck zu benutzen. 2019 wurde es dann in Blenheim Palace ausgestellt, einem stattlichen englischen Schloss, dem Geburts- und Wohnort von Winston Churchill. Am Tag nach der Eröffnung war das über fünf Millionen Franken teure Objekt dann auch schon weg. Die Diebe verursachten einen beträchtlichen Wasserschaden und schmolzen das Gold-Klo vermutlich sofort ein. Vier Männer wurden des Kunstdiebstahls angeklagt. Die Toilette bleibt bis heute unauffindbar. Der Künstler selbst nahm es mit Humor. Er bezeichnete die Diebe als «grossartige Performer» und bat sie, ihm mitzuteilen, ob ihnen die Toilette gefallen habe, und wie es sich anfühle, auf Gold zu pinkeln.

Laura Evens: Atlas der Kunstverbrechen. Prestel-Verlag 2025, 224 Seiten, 200 Farbabbildungen, ca. CHF 45.50.