
Missglückte Reise durch Deutschland (Kapitel 10.2) Aus «Schneesturm im Sommer»
In der Nacht ging mein Fieber zurück, ich fuhr am Tage darauf nach Leipzig, sah mir die Stadt wieder an und trieb mich im berühmten Bücherviertel herum, das mit seinem riesigen Bestand an Werken der Wissenschaft, Musik und Literatur, unter anderem auch mit Ausgaben von Othmar Schoeck und mit 8000 Bänden meiner hier verlegten Bücher noch vor Kriegsende unter den Bomben der Alliierten in Flammen aufgehen sollte. Nach einem angeregten Abend mit den Herren meines Verlages, die ich schon früher persönlich kennen und schätzen gelernt hatte, wurde ich in mein Hotel begleitet und ging zuversichtlich schlafen.
Den folgenden Abend verbrachte ich beim Schweizer Konsul, der mich zum Nachtessen eingeladen hatte. In seiner gepflegten, herrschaftlichen Wohnung lernte ich in ihm einen unverfälschten Berner und zugleich einen weltgewandten, gebildeten Mann kennen, der schon im Fernen Osten berufsmässig eine ähnliche Stellung bekleidet hatte. Der Schweizer bleibt als Weltmann besonders erfreulich, wenn seine herkömmliche Gestalt nicht zur Allerweltsfigur abgeschliffen wird, sondern, wie in diesem Fall, mit ihren ursprünglichen Eigenschaften eine weltläufige Form angenommen hat.
Nach dem Essen fuhr ich mit ihm zur Veranstaltung der Schweizer Kolonie, für die ein kleiner, vollgestopfter Gasthaussaal genügen musste, weil für grössere Säle keine Heizbewilligung zu erhalten war. Ich las Stücke vor, die unsere Landsleute daran erinnern konnten, dass wir daheim in einer bewährten, alten Demokratie lebten und nicht auf einen neuestens so laut angepriesenen Volksstaat zu warten brauchten. Um meine trockene, heisere Kehle zu schmeidigen, trank ichwährend der Vorlesung Wein statt Wasser, kam ins Feuer und las recht ordentlich. Nach umständlichen Vorbereitungen wurde ein Schmalfilm aus den Bergen und zuletzt aus purem Zufall noch der Reklamefilm einer norddeutschen Schiffahrtsgesellschaft gezeigt, der mit dem Sinn meiner Vorlesung nichts mehr zu tun hatte.
Ich war als «Sendbote der Heimat» vorgestellt worden und geriet am Schluss der Veranstaltung in ein Kreuzfeuer von Fragen und Antworten, dem ich nun wohl oder übel standhalten musste. Warum man in der Schweiz so sehr gegen Deutschland eingestellt sei und jedem beliebigen Schreiber erlaube, öffentlich über Zustände abzusprechen, über die er sich aus der Ferne doch kein Urteil bilden könne. Die Auslandschweizer im ganzen Reiche hätten es jeweilen zu büssen; sie bemühten sich ihrerseits um ein gutes Verhältnis zu diesem mächtigen Lande, das ihnen Gastrecht gewähre und sie arbeiten lasse, während man aus der kleinen Heimat durch ein kurzsichtiges und vermessenes Gebaren ihnen sozusagen in den Rücken schiesse. Man wolle doch neutral sein und solle sich also auch entsprechend verhalten. Das war die durchschnittliche Meinung eines grossen Teils der Schweizer in Deutschland.
Daneben gab es eine im folgenden Jahr noch wachsende Anzahl von Kleinmütigen, die an der Existenzmöglichkeit «dieses kleinen Drecklands in den Alpen», wie Göring über die Achsel hinwarf, dieses demokratischen Überbleibsels mitten in einem militärisch und politisch übermächtigen Staatengefüge verzweifelten und nur noch die Kapitulation für möglich hielten. Am schlimmsten waren die Angesteckten und Verführten, die einen schweizerischen Nationalsozialismus oder gar den Anschluss verfochten, doch lernte ich keinen von ihnen kennen, da sie ihre eigenen Zirkel bildeten und die Kolonie nur als Jagdgrund betrachteten. Dagegen traf ich überall auf Landsleute, die mit sowohl menschlicher wie politischer Entrüstung den Gang der Dinge in Deutschland eine Katastrophe nannten, in der Öffentlichkeit jedoch notgedrungen darüber schweigen mussten. Alle nicht geradezu abtrünnigen Schweizer aber, die ich traf, verrieten am Ende eine Anhänglichkeit an ihr kleines Dreckland, die aus einem tieferen Grunde stammte als ihre jeweilige politische Meinung.
Ich versuchte den Standpunkt der Heimat so gut zu formulieren, wie es mir möglich war, und wies vor allem auf die schwierige und heikle Notwendigkeit hin, einerseits die Neutralität zu wahren, anderseits aber im Nationalsozialismus den möglichen Angreifer zu erkennen und eine Gesinnung zu stärken, die es unter keinen Umständen erlaube, mit ihm zu paktieren.
Um meine Erkältung zu überwinden, blieb ich vierzig Stunden lang im Leipziger Hotel liegen. Hier begann ich das erschienene erste Buch von Ernst Jünger zu lesen, der mir wiederholt als tiefgründiger Repräsentant nicht der politischen Bewegung, aber des derzeitigen deutschen Geistes genannt worden war, das Kriegstagebuch «In Stahlgewittern», 151.–170.Tausend. Ich kam nicht mehr los davon. Das Bild der Materialschlachten im Stellungskrieg, das wir von Renn und Remarque her in seiner ganzen Hoffnungslosigkeit als Inferno kennen, wird hier als eine Art von Purgatorio nicht minder schrecklich, doch überraschenderweise unter einem positiven Vorzeichen dargestellt.
Man stösst auf eine Bejahung des Kampfes und Krieges, die in diesem Fall nicht psychologisch als eine jener Hypertrophien zu erklären ist, hinter der sich Schwäche verbirgt, sondern im Wesen dieses Mannes begründet sein muss. Er hat im Weltkrieg eine unerhörte Tapferkeit bewiesen, ist vierzehnmal verwundet und schliesslich mit dem Orden Pour le Mérite ausgezeichnet worden. Soll man nun fragen: Wie kommt dieser ausgezeichnete Schriftsteller dazu, ein solcher Kämpfer zu werden, oder: Wie kommt dieser Krieger dazu, so gut zu schreiben und darzustellen? Man möchte doch annehmen, dass er auf eine sehr deutsche Art aus der Not des Krieges eine Tugend gemacht hat, aber auch so bliebe er ein besonderer Typ von starker Wirkung, der irgendwie an den erstaunlichen Engländer T. E. Lawrence erinnert.
Zum Autor
Meinrad Inglin (1893–1971) Sohn eines Goldschmieds, Uhrmachers und Jägers, wurde mit siebzehn Jahren Vollwaise. Uhrmacher- und Kellnerausbildung, trotz fehlender Matura Studium der Literaturgeschichte und Psychologie in Bern, Genf und Neuenburg. Tätigkeit als Zeitungsredaktor, während des Ersten und Zweiten Weltkriegs Offizier im Grenzdienst. 1922 als Journalist in Berlin, danach als freier Schriftsteller in Schwyz. Für sein Werk (vor allem Romane und Erzählungen, einzelne Aufsätze, Notizen und eine Komödie) wurde Inglin vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Grossen Schillerpreis und dem Gottfried-Keller-Preis.
In der Frühe des Tages, an dem ich in Hamburg vorlesen sollte, spürte ich noch keine Besserung und hätte, was mich selber betraf, gern auf die Weiterreise verzichtet. Unser Auslandschweizer-Sekretariat aber hatte diese Vortragsreise ausgewichtigen Gründen veranstaltet und darum auch meine Zusage erhalten, es hatte in langen, mühevollen Vorbereitungen das ganze Unternehmen geregelt, Geld dafür ausgegeben und mir die Wege geebnet; in Hamburg, Frankfurt, Mannheim, Stuttgart und München wartete man auf mich, der Vortrag war angesagt, das Lokal reserviert, das Programm gedruckt. Wie hätte ich unter diesen Umständen mich wegen eines blossen Fiebers meinem Auftrag entziehen dürfen?
Ich fuhr nach Hamburg und nahm dort im Hotel mit unserem Generalkonsul Zehnder und dem Präsidenten des Schweizervereins eine Stunde vor dem Vortrag das Abendessen ein. Dabei war mir bald heiss, bald kalt, und das Essen schmeckte mir nicht. Der Generalkonsul legte mir eine Hand auf den Arm, behauptete, dass ich Fieber habe, und riet mir, sofort ins Bett zu gehen, statt vorzulesen. Ich weigerte mich, musste aber einwilligen, mir wenigstens noch das Fieber zu messen, und da ich 39,5 hatte, half keine Widerrede mehr. Ärgerlich über mein Versagen und bedrückt von der Möglichkeit, die Vortragsreise abbrechen zu müssen, aber schon richtig geschüttelt und geschwächt, legte ich mich in mein Hotelbett.
Als Erster betrat am nächsten Morgen Generalkonsul Zehnder mein Zimmer, ein älterer, aufgeschlossener, sympathischer Mann, der den Nationalsozialismus verabscheute und leider kurz vor Kriegsende auf seinem Posten bei einem Luftangriff sein Leben verlieren sollte. Da ich ihm keine Besserung melden konnte, besprach er mit mir auf seine ruhige, heitere Art alle notwendigen Anordnungen. Ihm verdanke ich, dass noch am selben Tage ein guter Arzt zu mir kam, ein Vorzug, den der Ausländer bei dem herrschenden Mangel an Ärzten und ihrer starken Beanspruchung nicht ohne weiteres erwarten durfte. Der Arzt, ein Sanitätshauptmann, entschuldigte sich, dass er in Uniform erscheine, und erwarb rasch mein Vertrauen, das sich in der Folge als gerechtfertigt erwies. Nach der Untersuchung liess er die Frage noch offen, ob ich eine Lungenentzündung habe oder nicht, verbot mir aber die Weiterreise und meinte, dass ich mir dafür dann wenigstens Hamburg richtig ansehen könne. Auf meine Bemerkung, dass mich vor allem der Hafen anziehe, die Küste, das Meer, erzählte er, die Nordsee sei in diesem strengen Winter ungewöhnlicherweise weit hinaus zugefroren.
In einer der folgenden Nächte weckte mich ein Sturm aus meinem verworrenen Halbschlaf, ein schwerer Weststurm, der stundenlang an den Fenstern fauchte und rüttelte. Ich dachte sogleich an den zugefrorenen Meeressaum und wurde von der Vorstellung gepackt, wie die Wellen den äussersten Eisrand bald überschwemmten, bald unterliefen und aufspalteten; sie wuchsen aus dem hochgehenden Meere zu Wogen an, die das Eis brachen, zerrissen, durcheinander schleuderten, so dass eine wild schäumende Brandung aus Eis und Wasser entstand, die sich donnernd und krachend auf breiter Front im sausenden Sturm allmählich der Küste zuwälzte. Tags darauf las ich in einem Hamburger Blatt, dass dies wirklich so oder ähnlich geschehen sei, und ich bedauerte, das erregende Schauspiel nur in der Vorstellung erlebt zu haben.
Indessen war mein Fieber noch gestiegen, ich mass wiederholt und mehr Grade, und die nächste Untersuchung durch den Arzt ergab, dass ich Lungenentzündung hatte. Der Generalkonsul, der mich bald durch das Telefon neben meinem Bette nach dem Befinden fragte, bald selber ins Zimmert rat, sagte mir nun, dass er meiner Frau in die Schweiz telegrafieren müsse. Ich ermass den Schrecken, in den sie dadurch versetzt würde, und riet entschieden ab, doch musste ich am Ende in ein Telegramm einwilligen, das ihr wenigstens den Sachverhalt mitteilte, die Reise nach Hamburg aber ihrem Belieben anheimstellte. Sie liess alles liegen, als sie die Nachricht empfing, und brach nach den verwickelten, vom Auslandschweizer-Sekretariat in Bern hilfreich beschleunigten Vorbereitungen unverzüglich auf.
Ich versuchte einen klaren Kopf zu behalten, aber langsam ging nun eine Änderung mit mir vor, die sich meiner Einwirkung entzog. Ich mass mir nach Vorschrift noch einmal das Fieber und las 40,7 ab, dann geriet ich, von gewohnten Gedanken und Gefühlen, auch körperlichen Gefühlen, nicht mehr behelligt, in einen Zustand ruhiger Sammlung. Mir schien, ich sei in eine durchsichtige, glühende rote Kugel eingeschlossen, die alles Unwesentliche, Störende von mir abhielt, ich fühlte mich darin tief geborgen und war bereit, ohne Widerstreben nun so zu erlöschen.
Ahnungslos, wie lange dieser Zustand gedauert hatte, sah und hörte ich den Arzt mit der Frage vor mich hintreten, ob er mir ein neues, von ihm noch unerprobtes, doch sehr empfohlenes Medikament geben dürfe. Ich nahm das Mittel und wurde im Verlaufe weniger Stunden zu meiner Verwunderung fieberfrei. Der Arzt war bei seinem nächsten Besuch darüber verblüfft und fand das Mittel wunderbar. Es war Cibazol, ein Basler Produkt, das damals in Deutschland als Eubasin, in Frankreich als Dagénan eben eingeführt wurde und durch seine frappante Wirkung in den verschiedensten Fällen sich rasch aller Welt empfahl. Mein Arzt betonte jedoch, dass die Gefahr damit zwar beschworen, der Heilungsprozess aber erst eingeleitet sei und durch eine sorgfältige Spitalpflege gefördert werden müsse.
Es erwies sich, dass alle Betten der Hamburger Spitäler besetzt waren, aber der Generalkonsul in seiner mir unvergesslichen, wahrhaft väterlichen Sorge, fand nach langem Suchen doch einen Platz für mich; ein evangelisches Diakonissen- und Krankenhaus, eine Zweiganstalt des Berner Diakonissenhauses, räumte dem kranken Schweizer ein Zimmer ein, und zwar, dem sonderbaren Stil der Reise entsprechend, in der Abteilung für Wöchnerinnen.
Zwei starke Männer trugen mich am sechsten Tage auf einer Bahre jene verschwiegenen Hintertreppen hinab, über die man auch Tote aus dem Hotel befördert. Die Angestellten, die uns begegneten, blickten mich halb neugierig, halb mitleidig an, während ich selber heiter und zuversichtlich gestimmt war.
- Die «Editorische Notiz» zum Buch finden Sie hier.
- Jeweils sonntags wird der Roman «Schneesturm im Hochsommer» auf zeitlupe.ch fortgesetzt.
- Weitere Kapitel können Sie hier lesen.
«Schneesturm im Sommer»
Meinrad Inglin ist einer der bekanntesten Unbekannten, seinen Namen kennen fast alle, seine Werke die wenigsten. Dabei ist er ein grosser Könner in einem grossen Spektrum unterschiedlicher literarischer Genres, stilistisch abwechslungsreich und sprachlich wohlkomponiert. «Schneesturm im Hochsommer» versucht, sein vielfältiges Schaffen abzubilden und damit einen literarisch hochinteressanten und oft überraschend aktuellen Schweizer Klassiker wieder breiter bekanntzumachen.
«Inglin ist seit Jahren genau der, von dem viele sagen, man hätte ihn ‹nicht auf dem Schirm› und der deshalb allen so präsent ist. Die Frage ist doch vielmehr: Was macht den Kerl so interessant, dass er nicht verschwindet? Er hat nie auf Effekt geschrieben. Er hat versucht, Verhältnisse zu beschreiben, wie sie sind. Eine Haltung, die nach dem ganzen postmodernen Klimbim auf eine neue Art interessant ist.»
Peter von Matt
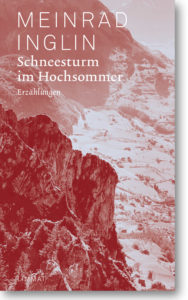
Meinrad Inglin, «Schneesturm im Hochsommer».
Herausgegeben von Ulrich Niederer, Nachwort von Usama Al Shahmani, 256 Seiten, Leinenband, CHF 28.– (UVP), Limmat Verlag, Zürich
Umschlagfotografie: Dino Reichmuth, Unsplash
Typografie und Umschlaggestaltung: Trix Krebs
Druck und Bindung: Friedrich Pustet, Regensburg
ISBN 978‑3‑03926‑021-8
© 2021 by Limmat Verlag, Zürich www.limmatverlag.ch
