18. Baurecht Aus «Politiker wider Willen»
Noch in Paris hat Pilet den letzten Satz seiner Dissertation geschrieben. Zurück in Lausanne zeigt er sie seinem Doktorvater Professor Paul Rambert, der gewisse Änderungen vorschlägt. Umschreiben? Pilet denkt nicht daran. Die Zeit wird es richten. Rambert wird schliesslich einsehen, dass Abänderungen nicht nötig sind. Tatsächlich erhält er schon bald von der Fakultät die Genehmigung zum Druck seiner Dissertation.
Sein Thema hat er auf Anraten von Rambert gewählt, Professor für Waadtländer und Schweizer Zivilrecht. Dieser arbeitet an der Einführungsgesetzgebung für das ZGB, das Anfang 1912 in Kraft tritt. In Lausanne, wo auf Gemeindeboden fieberhaft gebaut wird, haben Fragen des Baurechts mehr als bloss theoretische Bedeutung. Pilet hat gesehen, dass dessen Behandlung im ZGB mangelhaft ist. Ein lohnendes Dissertationsthema.
Das aus der Römerzeit stammende, in Vergessenheit geratene Baurecht – das Recht, gegen ein regelmässiges Entgelt auf fremdem Boden ein Gebäude zu errichten und zu nutzen – wurde am Ende des 19. Jahrhunderts neu entdeckt und fand Eingang in die Gesetzgebung in Deutschland, später auch in der Schweiz. Vielerorts setzte man grosse Hoffnungen in die verjüngte Institution. Gemeinden, Stiftungen, Gesellschaften, die Grundstücke besassen, aber diese nicht veräussern wollten, konnten den Boden gegen ein regelmässiges Entgelt einer Person oder einer Körperschaft, oft einer Wohnbaugenossenschaft auf eine festgelegte Dauer überlassen. Von der Einführung des Baurechts versprach man sich die Förderung des sozialen Wohnungsbaus, die Eindämmung der Bodenspekulation, die in Lausanne ins Kraut schoss, und die Sanierung der öffentlichen Haushalte.
Es gibt bereits wissenschaftliche Studien zum Baurecht, die jedoch nach Pilets Meinung einseitig entweder dessen Vorzüge loben oder aber dessen Nachteile herausheben. Er selbst hat vor, das Baurecht «frei von jedem politischen Anliegen, jeder Voreingenommenheit – gewollter und ungewollter – einfach als Jurist zu studieren». Er tut dies mit der ihm eigenen Sorgfalt und liefert ein wohldurchdachtes, elegantes Werk ab, das mit dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch hart ins Gericht geht. Ein unvollkommeneres Instrument als das Baurecht im ZGB lasse sich nicht finden, meint der 22-jährige cand. iur.:
Die komplexe Natur dieses Gesetzes und die verschiedenen, oft entgegengesetzten Interessen, die es ins Spiel bringt, verlangen eine gesetzliche Regelung vom Minutiösesten. Gerade das Gegenteil ist geschehen. Der Gesetzgeber hat sich nicht einmal die Mühe genommen, das Notwendige zu sagen.
Pilet kommt zum Schluss, dass das Baurecht, das auf dem Papier sehr viel verspricht, in der Realität bloss zu Konflikten zwischen Grundbesitzer und Baurechtnehmer führt: Ihre Interessen sind zu widersprüchlich:
Überall, wo man auf fremdem Boden Wohnungen gebaut hat, hat man sich nach einigen Jahren über deren Baufälligkeit und deren Unsauberkeit beklagt.
Das Baurecht, so Pilet, sei keineswegs das unfehlbare Mittel gegen teure und unhygienische Wohnungen. Das beste Mittel, um die armen Schichten der grossen Städte anständig unterzubringen, liege darin, zahlreiche komfortable Häuser zu bauen und diese billig zu vermieten. Ob dies auf dem eigenen oder fremdem Boden geschieht, sei unwichtig!
Dies koste allerdings sehr viel Geld, fügt der Doktorand hinzu. Wenn man dieses Geld einmal habe, werde sich die Wohnungsfrage, wie auch die soziale Frage, leicht lösen lassen. Solange jedoch das Geld fehle, werde man die Lösung auch auf juristischem Gebiet nicht finden. Pilet schliesst seine Dissertation: «Man macht aus Worten kein Gold. Auf wirtschaftlichem Gebiet muss man die Lösung finden. An die Arbeit, Ökonomen!»
Sind dies die Worte eines Juristen oder nicht eher eines sich noch im Raupenstadium befindenden politischen Schmetterlings?
Zum Autor
Hanspeter Born, geb. 1938, Schulen in Bern, Dr. phil. hist.; Redaktor beim Schweizer Radio, USA-Korrespondent; Auslandchef der Weltwoche (1984–1997); Autor von Sachbüchern, darunter «Mord in Kehrsatz», «Für die Richtigkeit –Kurt Waldheim» sowie (mit Benoit Landais) «Die verschwundene Katze» und «Schuffenecker’s Sunflowers».
Pilet kann logisch argumentieren und klar formulieren. Seine am später fast als Denkmal verehrten Zivilgesetzbuch geäusserte Kritik verrät jugendliche Unerschrockenheit. Der Doktorand wirkt selbstbewusst, fast überheblich – hat wohl auch Grund dazu. Auf den 250 Seiten der Schrift dringt der leicht ironische Ton durch, der schon dem Gymnasiasten eigen war. Die Dissertation zeigt zudem, dass Pilet die Warnung vor politischem Wunschdenken, die sich durch das Werk Vilfredo Paretos zieht, beherzigt hat: «Die Tatsachen, par malheur, haben diesen schönen Verheissungen widersprochen», schreibt er. Gesetze führen nicht immer zum gewünschten Ziel. Man muss auf dem Boden der Wirklichkeit bleiben.
Marcel Pilet hat jetzt zwar den Titel Dr. iur., aber noch fehlt ihm das zur Ausübung des Anwaltsberufs nötige Patent. Um dies zu erwerben, braucht es praktische Erfahrung und die eignet er sich als stagiaire in der «sehr bekannten» Anwaltspraxis von Ernest Vallon an. Vallon war in seiner Studienzeit wie Pilet ein leidenschaftlicher Bellettrien, zudem Zentralpräsident der Verbindung, und teilt dessen Interesse an der Literatur. Ihre fruchtbare Zusammenarbeit wird bis zur Wahl Pilets in den Bundesrat andauern, Vallon soll ein höflicher, liebenswerter Zeitgenosse gewesen sein, ein brillanter Anwalt «von prickelndem ésprit», dessen Sprüche gefürchtet waren. 1922 werden ihn seine Waadtländer Kollegen zum Präsidenten der Anwaltskammer, zum bâtonnier, wählen.
Praktikanten erhalten die undankbaren Fälle zugeteilt, die den Patron nicht interessieren. Pilet amtet als Pflichtverteidiger für einen Einbrecher, einen Handtaschendieb und andere Kleinkriminelle. Im Juli 1913 befasst sich das Gericht in Orbe mit einer Auseinandersetzung unter italienischen Arbeitern, die mit dem Tod eines der Streithähne endete. Pilet vertritt einen Mitangeklagten, den Bruder des mit Pistolenschuss getöteten Opfers, der sich ebenfalls an der Schlägerei beteiligt hatte und durch einen Streifschuss verletzt worden war. Sein Klient wird freigesprochen.
Nach Absolvierung der zweijährigen Praktikantenzeit und Bestehen des Examens erhält Marcel Pilet am 10. Mai 1915 das Waadtländer Anwaltsbrevet und wird Partner in der Kanzlei seines Lehrmeisters, die jetzt Cabinet Vallon et Pilet heisst.
- Jeweils sonntags wird der Roman «Politiker wider Willen. Schöngeist und Pflichtmensch» auf zeitlupe.ch fortgesetzt.
- Fotos und Dokumente zum Buch
- Diese Kapitel sind bereits erschienen
«Politiker wider Willen»
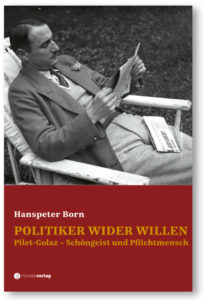 Der aus kleinbürgerlichen Verhältnissen stammende, hochbegabte, literarisch und künstlerisch interessierte Marcel Pilet ergreift entgegen seiner eigentlichen Vorlieben den Anwaltsberuf und geht in die Politik. Nach kurzer, erfolgreicher Tätigkeit im Nationalrat wird Pilet-Golaz, wie er sich nun nennt, mit noch nicht vierzig Jahren als Verlegenheitskandidat in den Bundesrat gewählt. Dank seines soliden juristischen Wissens, seiner militärischen Kenntnisse und seines bon sens übt er einen gewichtigen Einfluss auf die Schweizer Politik aus. Allerdings bringen viele Deutschschweizer dem verschlossenen, romantischen und mit bissiger Ironie gesegneten Waadtländer nur wenig Verständnis entgegen, als er 1940 als Bundespräsident die Geschicke des Lands in die Hand nimmt.
Der aus kleinbürgerlichen Verhältnissen stammende, hochbegabte, literarisch und künstlerisch interessierte Marcel Pilet ergreift entgegen seiner eigentlichen Vorlieben den Anwaltsberuf und geht in die Politik. Nach kurzer, erfolgreicher Tätigkeit im Nationalrat wird Pilet-Golaz, wie er sich nun nennt, mit noch nicht vierzig Jahren als Verlegenheitskandidat in den Bundesrat gewählt. Dank seines soliden juristischen Wissens, seiner militärischen Kenntnisse und seines bon sens übt er einen gewichtigen Einfluss auf die Schweizer Politik aus. Allerdings bringen viele Deutschschweizer dem verschlossenen, romantischen und mit bissiger Ironie gesegneten Waadtländer nur wenig Verständnis entgegen, als er 1940 als Bundespräsident die Geschicke des Lands in die Hand nimmt.
«Politiker wider Willen» ist der erste Teil einer auf drei Bände geplanten Biographie über Marcel Pilet-Golaz.
Hanspeter Born, Politiker wider Willen. Pilet-Golaz – Schöngeist und Pflichtmensch. Münster Verlag 2020, gebunden, mit Schutzumschlag, 520 Seiten, ca.CHF 32.–. ISBN 978-3-907 301-12-8, www.muensterverlag.ch
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlagsgestaltung: Stephan Cuber, diaphan gestaltung, Liebefeld; Satz: Stephan Cuber, diaphan gestaltung, Liebefeld; Druck und Einband: CPI books GmbH, Ulm; Printed in Germany
