
Elisabeth Bronfen: «Glück macht überhaupt nicht kreativ»
Elisabeth Bronfen hat 30 Jahre an der Uni Zürich gelehrt. Die Kulturwissenschaftlerin sagt, wie uns Literatur in Krisenzeiten helfen kann, warum ein Tag ohne Kochen ein trauriger Tag ist, und wie es kommt, dass sie überall ein bisschen fremd ist.
Text: Franz Ermel; Fotos: Christian Senti
Elisabeth Bronfen, Sie sind in Deutschland geboren, leben seit vielen Jahren in Zürich. Sie sind US-Bürgerin …
… und Schweizerin …
… wo fühlen Sie sich zu Hause?
Ganz eindeutig in Zürich! Ich habe mein halbes Leben hier verbracht. Wenn ich am See vorne über die Quaibrücke gehe oder die Ansagen am Bahnhof höre, wird mir ganz wehmütig.
Sie sind in München aufgewachsen. Ihr Vater war Amerikaner, Ihre Mutter Deutsche. Wie hat Sie das geprägt?
Meine Eltern lernten sich in Bayern kennen. Mein jüdisch-amerikanischer Vater war nach dem Zweiten Weltkrieg mit der US-Militärregierung nach Deutschland gekommen. Ich lebte tatsächlich in zwei Welten, weil wir zu Hause Deutsch sprachen, aber auf die amerikanische Schule gingen, wo wir Englisch sprachen, in der Mensa amerikanisches Essen assen und amerikanische Sitten pflegten. Meine Geschwister und ich verbrachten jeden Tag sechs Stunden in dieser für uns fremden Welt, bevor wir mit dem Schulbus zurück in unsere vertraute Welt fuhren. Ich bin deshalb nicht einfach zweisprachig, sondern bikulturell gross geworden.
Was meinen Sie damit?
Man kann das positiv oder negativ sehen. Früher hat es mich oft bedrückt, dass ich nicht nur eine Muttersprache und eine Heimat habe; und auch heute fühle ich mich immer und überall ein klein wenig fremd. Positiv ist: Man denkt in verschiedenen Sprachen und somit aus verschiedenen Perspektiven. Geht es um kulturelle Konflikte, kann ich mehr als eine Position sehen, weil ich selbst verschiedene Seiten in mir habe.

Dann lassen Sie uns über Ihre amerikanische Seite sprechen. Was passiert gerade in den USA?
«Gerade» ist sehr unscharf als Begriff, denn unter Trump ändert sich die Situation von Woche zu Woche. Die Demokraten sind immer noch in einem Zustand der Verunsicherung und wissen nicht genau, wie sie ihre Partei neu ausrichten sollen. Aber wir sehen, wie sich allmählich Widerstand gegen die Regierung bildet. Mit den Protesten in Los Angeles und anderswo ist der zivile Ungehorsam erwacht. Es geht mit dem Thema Immigration plötzlich um etwas, was einen konkret betrifft. Auch Leute, die Trump gewählt haben, sagen: Natürlich sind wir gegen illegale Immigranten, die Mitglieder von irgendwelchen Drogenkartellen sind, aber doch nicht gegen die reizende Chinesin, die uns seit 20 Jahren im Restaurant bedient.
Trump scheint sich aber darum zu foutieren.
Trump hat tatsächlich die ersten Monate mit erstaunlich viel Energie und auch Kreativität durchregiert, wie kaum ein anderer Präsident vor ihm. Die Regierung reisst sehr viel Macht an sich. Die Konsequenzen aus seinen zahlreichen Executive Orders werden erst langsam klar.
Ist das eine Machtergreifung?
Nein. Ich halte den Faschismusvergleich in diesem Fall nicht für zielführend; zumindest noch nicht. Noch gibt es Richter, die den Verordnungen der Trump-Regierung etwas entgegenzusetzen versuchen, noch haben wir in den Medien unterschiedliche Positionen und unterschiedliche Lager. Die Sache ist mobil. Aber wachsam muss man trotzdem sein.
Trump nimmt auch die Unis ins Visier, insbesondere Harvard, wo Sie selbst studiert haben. Wie stehen Sie dazu?
Das ist tatsächlich ein massiver Eingriff in die Forschungsfreiheit, den ich für sehr beunruhigend halte. Mit dem Zurückbehalten von Geldern für die naturwissenschaftliche Forschung sollte man kein Exempel statuieren, so wie Trump das tut. Auch der flächendeckende Vorwurf eines grassierenden «Antisemitismus» muss differenziert betrachtet werden. Die interne Taskforce, die sich mit dieser Frage an der Harvard-Universität auseinandergesetzt hat, hat genau das getan. Um so erschütternder ist deren Befund, dass sich jüdische und israelische Studierende und Dozierende teilweise nicht sicher fühlen, und das nicht erst seit dem Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023.
Sie sagen: Fiktion hilft, die Realität besser zu verstehen, gerade in Krisenzeiten. Trifft das auf alle Krisen zu – vom Ukraine-Krieg bis zum Chaos unter Trump?
Unbedingt! Diese ganzen Krisen verleiten mich förmlich dazu, in der Literatur nach ähnlichen Situationen zu suchen und zu überlegen: Wie hat eine ähnliche Situation die Leute beeinflusst? Wie konnten sie sich orientieren? Man kann die Fiktion nicht mit der Realität gleichsetzen, aber weil es ähnliche Verhaltensweisen gibt, lässt sich durch die Fiktion sehr viel erkennen, weil man es aus einer gewissen Distanz beobachtet.
Diese These war ursprünglich auf die Pandemie gemünzt. Haben wir Corona überstanden?
Überstanden vielleicht, überwunden wahrscheinlich nicht. Viele Leute haben die Krise einfach vergessen – sei es aus Bequemlichkeit oder aus Notwendigkeit. Die Amerikaner etwa haben vergessen, wie unglaublich fahrlässig die Trump-Regierung während der Covid-Krise war.
«Auch heute fühle ich mich immer und überall ein klein wenig fremd.»
Sie waren 30 Jahre an der Uni Zürich Professorin für englische Literatur. Was schätzen Sie an der Schweiz?
Die direkte Demokratie, also die Tatsache, dass hier alle Leute angehalten werden, sich ständig mit Politik auseinanderzusetzen, sich verantwortlich zu fühlen. Ich schätze auch eine gewisse altmodische Verlässlichkeit. Aber auch dieses Vorsichtige, dieses «Wir müssen uns das noch ein bisschen genauer überlegen», mag ich.
Und was irritiert Sie?
Dieses Vorsichtige hat natürlich eine Kehrseite: Die Schweiz ist kein Ort für radikale, extrem kreative oder innovative Arbeit. Ich verstehe, dass das Land für ganz junge Leute, die etwas absolut Neues machen wollen, zu eng ist. Ich muss aber auch zugeben: Mir gefällt das mit zunehmendem Alter immer besser.
Wie erleben Sie das Älterwerden?
Widersprüchlich. Ich leide seit längerem schon an Arthrose in den Knien. Ich bin physisch nicht mehr so agil, wie ich es einmal war. Vor 15 Jahren konnte ich Yoga-Übungen, an die ich heute nicht einmal mehr denken darf.

Und die positive Seite?
Eine unglaubliche Erleichterung!
Inwiefern?
Dieses Gefühl: Es gibt Dinge, die ich nicht mehr tun werde, die ich nicht mehr erforschen will; Angelegenheiten, bei denen ich mich nicht mehr einsetzen muss; genau einschätzen zu dürfen, was mir weiterhin wichtig ist. Das ist eine grosse Erleichterung.
Lernen Sie von Jüngeren?
Ich behaupte, sie könnten wahnsinnig viel von mir lernen, ich bin doch eine Autorität! (Schmunzelt) Im Ernst: Teilweise sehe ich ein Selbstbewusstsein, eine Leichtigkeit, gerade bei jungen Frauen, die mir sehr gefällt. Von ihnen lerne ich.
Was machen Sie, wenn Sie zur Ruhe kommen wollen?
Ich sollte das natürlich jetzt nicht sagen, aber ich sage es trotzdem: Ich sitze wahnsinnig gerne mit einem Glas Wein auf meinem Balkon; manchmal werden es sogar zwei oder drei. Und dann beobachte ich, wie die Sonne hinter den Gebäuden versinkt und der Mond langsam aufsteigt. Damit kann ich Stunden verbringen. Ich schaue mir einfach diese fantastische urbane Landschaft an. Dann fliessen die Gedanken.
«Älterwerden erlebe ich widersprüchlich. Aber es ist auch eine unglaubliche Erleichterung.»
Kommt Ihre Faszination für das Abgründige von diesen Abenden auf dem Balkon? Sie haben ja auch eine Kulturgeschichte der Nacht geschrieben.
Tatsächlich interessieren mich die dunklen Seiten einer Sache, die gewalttätigen Aspekte, da, wo es beunruhigend wird und die Leute nur ungern hingucken. Ich will die Dinge im Kern ergründen, da bin ich als Intellektuelle streng – mein Vorbild war immer Hannah Arendt. Es ist auch ein bisschen eine Haltung gegenüber einer Verbiedermeierung, wo man versucht, alles schön zu malen und sauber zu machen. Sentimentalität schätze ich als Haltung nicht, und die Idylle, die macht mir eher Angst, die finde ich sehr beunruhigend!
Reden wir über das Essen, eine Ihrer grossen Leidenschaften. Sie sagen, ein Tag ohne Kochen sei ein trauriger Tag.
Ja, das ist so. Selbst an stressigen Tagen – in dem Moment, wo ich die Küche betrete und meine Zutaten auspacke und zu kochen beginne, setzt ein Gefühl von Fröhlichkeit ein. Und eine grosse Ruhe.
Ist Kochen eine Fortsetzung oder ein Kontrast zu dem, was Sie sonst tun?
Vielleicht eher ein Sprung weg vom Lesen, Schreiben, Schauen. Denn sobald man in der Küche ist, kann man nicht mehr über andere Dinge nachdenken. Sonst verletzt man sich oder versalzt das Essen.
Sie beschreiben Kochen als weiblich konnotiertes Feld. Aber auch als Ort der Selbstermächtigung. Wie passt das zusammen?
Ich rede natürlich vom Homecooking, denn zu Hause kochen ja traditionell die Frauen. Sie hatten zwar immer die Macht in der Küche, aber es war eine ihnen zugeschriebene Macht, die dadurch definiert war, dass sie eben nicht in die Aussenwelt, auf die Strasse und auf die Uni gehen durften. Es war eine Reduktion auf das Kochen, die später dazu führte, dass viele professionelle Frauen mit der Küche nichts mehr zu tun haben wollten. Heute sehen wir die Rückeroberung der Küche als Ort, wo Frauen selbst definieren, was sie kochen, für wen sie kochen und wann sie kochen.
Und die Männer?
Die Männer kochten ursprünglich ja vornehmlich in den Restaurants – vorzugsweise natürlich in Sterne-Restaurants. Heute, wenn ich nach der Arbeit in dem kleinen Comestibles-Laden hier um die Ecke einkaufe – wer ist die Hauptklientel? Männer! Weil das für sie ein Terrain ist, das sie jetzt für sich entdecken können. Ein Banker in der Küche war vor fünfzig Jahren undenkbar.
«Mach etwas Fröhliches aus dem Essen»
Was würden Sie jemandem raten, der täglich kochen muss, damit das nicht zur lästigen Pflicht wird?
Mach etwas Fröhliches aus dem Essen! Denn ich bin überzeugt, dass man die Stimmung, in der man ist, mit verkocht. Das ist auch die Idee hinter meinem neuen Kochbuch, bei dem es um meine Stimmungsküche geht. Ich möchte, dass die Leute die Gefühlslage, in der sie sind, wahrnehmen und danach kochen. Es geht mir um drei Dinge: die Stimmung um mich herum, die Stimmung, die ich produzieren will, und die Stimmung, in der ich selber bin. Für das Buch habe ich mir zwölf Gegensatzpaare ausgedacht: viel Zeit – wenig Zeit; glücklich – traurig; heiss – kalt usw.
Was machen Sie damit?
Ich beginne jeweils mit einer Reflexion, zum Beispiel mit der Frage: Was ist Traurigkeit? Was kocht man, wenn die Melancholie einen überfallen hat? Traurigkeit macht kreativ, weil man seine Stimmung verändern will. Glück dagegen macht gar nicht kreativ, aber es macht grosszügig, weil man doch so viel Zufriedenheit hat und den anderen etwas davon abgeben kann. In beiden Fällen empfiehlt sich schwarze Schokolade, allerdings jeweils anders eingesetzt – je nachdem, ob ich Traurigkeit zerstreuen oder Glück potenzieren will.
Gibt es Zutaten, auf die Sie nie verzichten können?
O ja. Olivenöl, Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer, Butter – viel Butter. Und natürlich, was es nur hier gibt: Double Crème de Gruyère. Mein Gott, wenn man mir die Double Crème de Gruyère wegnehmen würde! Ich wäre sehr, sehr traurig. 
Zur Person
- Elisabeth Bronfen wurde 1958 in München als Tochter eines jüdisch-amerikanischen Vaters und einer deutschen Mutter geboren. Sie wuchs zweisprachig auf.
- Sie studierte u. a. in Harvard und München englische und deutsche Literatur und Komparatistik. Von 1993 bis 2023 war sie Professorin für englische und amerikanische Literatur an der Uni Zürich.
- Sie wurde einem breiteren Publikum bekannt für ihre kulturkritischen Analysen, in denen sie Literatur, Film, Fernsehen, Kunst und Popkultur zusammenbringt. 2016 erschien ihr erstes Kochbuch,
«Besessen», 2023 ihr erster Roman, «Händler der Geheimnisse». - Elisabeth Bronfen lebt in Zürich.
Dreimal Bronfen
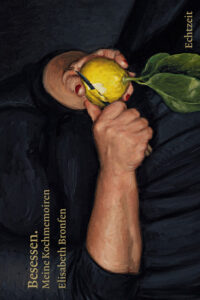 Kochen
Kochen
«Besessen» ist keine klassische Rezeptsammlung – Elisabeth Bronfen nennt es ihre «Kochmemoiren». Sie gibt Einblick in ihre Alltagsküche mit einfachen, aber perfekt zubereiteten Speisen. Die Rezepte sind verwoben mit vielen persönlichen Erinnerungen und kulturwissenschaftlichen Reflexionen.
«Besessen. Meine Kochmemoiren», Echtzeit, ca. CHF 46.–
 Krise
Krise
In «Angesteckt» blickt Elisabeth Bronfen auf Corona – und zeigt, wie Film und Literatur uns helfen können, Pandemien und ähnliche Krisen zu begreifen. Denn diese sind nicht bloss medizinische, sondern auch kulturelle Ereignisse, die Ängste und Machtverhältnisse offenlegen.
«Angesteckt. Zeitgemässes über Pandemie und Kultur», Echtzeit, ca. CHF 34.–
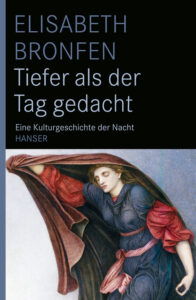 Nacht
Nacht
Elisabeth Bronfen erkundet in «Tiefer als der Tag gedacht» die menschliche Faszination für die Nacht: Von antiken Mythen bis zur Popkultur der Gegenwart verfolgt sie, wie die Nacht als Symbol für das Geheimnisvolle, die Verwandlung und den Tabubruch unser Denken und Fühlen prägt.
«Tiefer als der Tag gedacht. Eine Kulturgeschichte der Nacht», Carl Hanser Verlag, ca. CHF 44.–